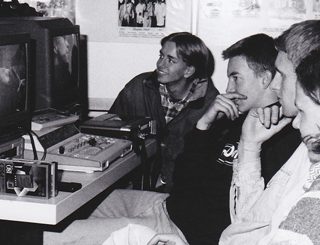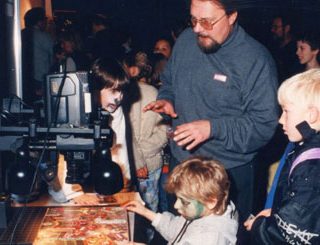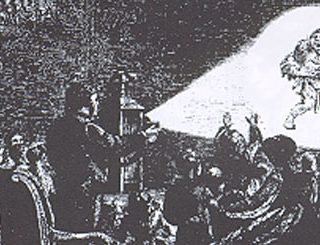Projekt ‚Offener Kanal und Schule‘ 1996 bis 1999
In Kooperation mit dem damaligen Offenen Kanal Wolfsburg-Braunschweig und der Medienwerkstatt Linden realisierten das damalige NLI und die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) ein Projekt zur aktiven Medienarbeit. Ziel war es, Lehrerinnen und Lehrer als Multiplikatoren an die Angebote und Möglichkeiten eines Offenen Kanals heranzuführen und ihnen methodische und didaktische Hinweise für den praktischen Medienunterricht in der Schule zu eröffnen.