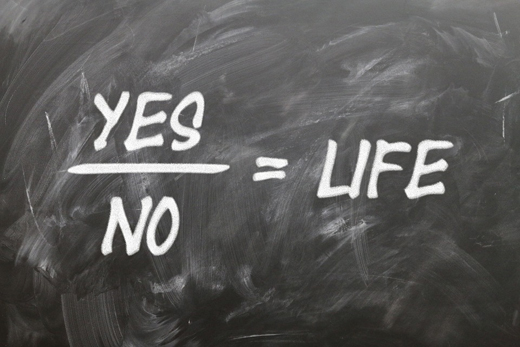Zur Arbeit mit filmischen Quellen
Dokumentar- und Spielfilme als historische Quellen
Filme sind stets gestaltete Realität und keine objektiven Abbilder. Sie zeigen Ereignisse und gleichzeitig Sichtweisen darauf. Als historische Quellen haben sie sowohl Traditions- als auch Überrestwert. Besonders Spielfilme spiegeln unbewusste zeitgenössische Einstellungen wider. Eine kritische Analyse erfordert Kenntnisse filmischer Gestaltungsmittel sowie äußere und innere Quellenkritik. Ziel ist nicht Objektivität, sondern das Offenlegen von Bedeutungszuweisungen.

Quellenwert von Filmaufnahmen
Der Beitrag von Peter Stettner (2020) analysiert den Film als historische Quelle und betont, dass Filme stets gestaltete Realität zeigen. Er fordert eine kritische Auseinandersetzung mit filmischen Mitteln und Erzählperspektiven, um deren Aussagekraft als Überrest- und Traditionsquelle zu verstehen.
Dokumentarfilm als historische Quelle
Der Beitrag von Peter Stettner (2008) beleuchtet den Dokumentarfilm als historische Quelle und zeigt, wie filmische Gestaltung, Kommentar und Kontext die Aussagekraft beeinflussen. Er fordert eine kritische Quellenanalyse, um zwischen Abbild und Interpretation zu unterscheiden und historische Erkenntnisse zu gewinnen.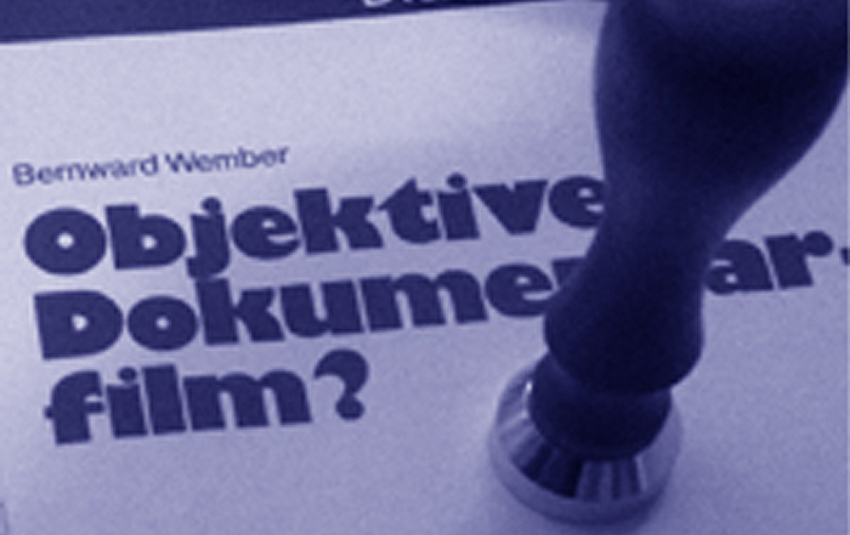
Objektivität im Dokumentarfilm
D. Endeward formuliert sieben Thesen zur Objektivität im Dokumentarfilm. Er zeigt, dass filmische Wirklichkeit stets subjektiv konstruiert ist – durch Auswahl, technische Gestaltung und Montage. Objektivität ist ein Mythos; gefordert wird stattdessen filmische Ehrlichkeit und medienkritische Kompetenz.
Arbeit mit Spielfilmen als zeitgeschichtliche Quellen
Der Beitrag von Detlef Endeward (1989) betont den Quellenwert von Spielfilmen für die historisch-politische Bildung. Er kritisiert ihre rein illustrative Nutzung im Unterricht und fordert eine tiefere Analyse ihrer Entstehungszeit, Ideologie und Gestaltung, um sie als zeitgeschichtliche Quellen ernst zu nehmen.