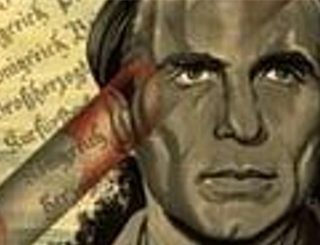Spielfilmanalyse und sozialpsychologische Beschreibungen
Die folgende Gesamtzusammenfassung versucht, die in den Einzeldarstellungen enthaltenen Beobachtungen noch einmal in ihrem inhärenten Zusammenhang anzudeuten und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Nachkriegsentwicklung und Ausprägung einer kollektiven politischen Identität zu reflektieren.