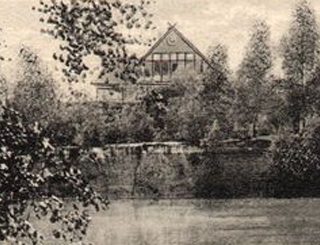Schlagwörter: Arbeiterbewegung
Aus fast ausschließlich eigenen finanziellen Mitteln und in gemeinsamer Arbeit entstand in Mellendorf am Lönssee 1922 und an vielen anderen Orten Deutschlands bis 1929 ein Netz von 241 Schutzhütten und Heimen. Kollektiver Häuserbau, gemeinsames Planen und Arbeiten schien für viele damals ein Stück verwirklichter sozialistischer Utopie auszudrücken.
Heraus aus den lauten und dumpfen Fabriken, den engen Wohnungen, den Kneipen. Weg von Tabak und Alkohol, zum gemeinsamen Wandern in die frische Waldluft, so lauteten die Forderungen der Naturfreunde.
Organisationen in der Arbeiterschaft blieben nicht auf den politischen und den gewerkschaftlichen Bereich beschränkt. Von Beginn an entwickelte sich ein klassenbewusstes kulturelles und geselliges Vereinsleben. Viele Arbeitervereine standen der SPD nahe.
Das Gewerkschaftshaus, 1910 in der Nicolaistraße eingerichtet, und das benachbarte Volksheim von 1919 entwickelten sich zu kommunikativen Zentren der hannoverschen Arbeiterbewegung.
Die Arbeiterbewegung war bis zu ihrer Zerschlagung 1933 eine starke Kraft, nicht nur im politischen Bereich. Sie hatte sich auch auf kultureller Ebene und im Sport organisiert.
Das 1. Fest des Deutschen Arbeiter-Sängerbundes fand vom 16. bis 18. Juni 1928 in Hannover mit zwischen 44.000 und 50.000 Teilnehmern statt. Das Sängerfest wurde von Reichstagspräsident Paul Löbe eröffnet.
Rätesystem oder Parlamentarismus? Detlef Endeward 06/2025 Die Revolution von 1918/19 steht als Zäsur am Übergang vom deutschen Kaiserreich zur parlamentarischen Republik. Ausgelöst durch die kriegsbedingte soziale Notlage, das Versagen der monarchischen Führung sowie den zunehmenden Druck einer organisierten Arbeiterschaft, entfaltete...
Als „Klassen“ werden Personenvielheiten bezeichnet, die durch den Besitz bzw. Nicht-Besitz an (Verfügungsmacht bzw. Nicht-Verfügungsmacht über) Kapital und daraus folgende gemeinsame bzw. entgegengesetzte Interessen definiert sind, die sich der Tendenz nach aufgrund dieser Merkmale als zusammengehörig bzw. einander entgegengesetzt begreifen und die sich – wieder der Tendenz nach – auf dieser Grundlage zu gemeinsamen bzw. entgegengesetzten Aktionen zusammenschließen und organisieren.
Not und Elend, Geschäftsaufgaben und Firmenpleiten, SA-Terror und Polizeigewalt, Protest, Streiks und die Notverordnungspolitik der Präsidialkabinetten kennzeichnen die letzten Jahre der Weimarer republik.
In der Wirtschaftskrise nahm die Verelendung großer Teile der Arbeiterklasse in verschärftem Tempo zu: Diese Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen vollzog sich in vier Bereichen: Erhöhung der Zahl der Arbeitslosen und Kurzarbeiter;
Herabsetzung des Reallohns der beschäftigten Arbeiter; Erhöhung der Intensität der Arbeit; Abbau der sozialen Versorgngsleistungen.
Nach verlorenem Weltkrieg galt der Mensch als besonders wichtiges „Kapital“, in das „investiert“ werden müsse, vor allem in Jugendliche. Gesundheit und Lebenstüchtigkeit standen auf dem Spiel, so argumentierten bürgerliche Sozialreformer und -reformerinnen.