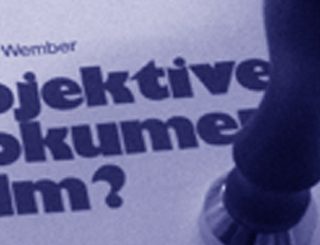Das Medium „Historischer Spielfilm“
Der Beitrag beschreibt den historischen Spielfilm als populäres Medium mit hohem Einfluss auf das Geschichtsbewusstsein. Sie zeigt, wie Fiktion und historische Fakten verwoben sind, und fordert eine kritische Auseinandersetzung im Unterricht, um mediale Geschichtsbilder zu reflektieren.