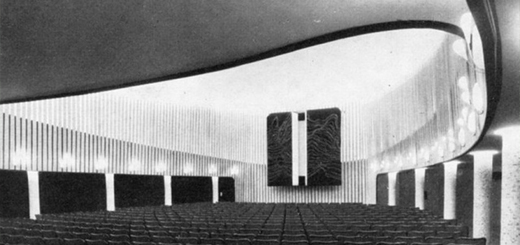Film im Ersten Weltkrieg
Lichtspiel statt Schlachtfeld? Der Erste Weltkrieg auf der Leinwand
Detlef Endeward 06/2025
»Aus dem nächsten Kriege. General: Also seid tapfer Kinder, bedenkt, die Kinetoskopen
der ganzen Welt sind auf Euch gerichtet!«
Mit diesem Zitat aus der Berliner Satirezeitschrift LUSTIGE BLÄTTER vom Frühjahr 1898 leitet Bernd Kleinhans seinen Beitrag „Der Erste Weltkrieg ein Medienereignis“ ein [1] und folgert, dass die Zeitschrift recht behalten hätte.
Der 16 Jahre später beginnende Erste Weltkrieg wurde tatsächlich zum ersten wirklichen Medienkrieg.
„Aber erst der Weltkrieg von 1914-1918 sollte zum modernen Medienkrieg, mithin zum Filmkrieg werden: Die bewegten Bilder dokumentierten das Geschehen nicht nur, sondern sie wurden zum authentischen Medium der Wahrnehmung und Teilhabe ebenso wie der Sinndeutung: Wegen der großen Zahl der beteiligten Soldaten – allein im Deutschen Reich waren während des Krieges mehr als 13 Millionen Männer einberufen – und der vollständigen Involvierung der Zivilgesellschaft – General Ludendorff wird das später in seinen Erinnerungen »totalen Krieg« nennen – war praktisch die gesamte Bevölkerung betroffen und hatte dadurch ein erhebliches Informationsbedürfnis.
Andererseits war der Krieg selbst weitgehend dem eigenen Beobachten und Erleben unzugänglich. Für die Menschen in der Heimat ohnehin, da sie vom Frontgeschehen praktisch nichts mitbekamen. Aber selbst für die Soldaten in den Schützengräben war der Krieg in seiner Totalität unsichtbar.“[2]
Propaganda eine Waffe, die nicht tötet – zumindest nicht unmittelbar
Ein Aspekt des „Medienereignisses Krieg“ ist die Nutzung der Medien für propagandistische Zwecke. Für den Unterricht bedeutsam sollte dabei nicht die schlichte Frage nach propagandistischer Manipulation sein, sondern die Möglichkeit, einen Blick zu werfen auf das Wechselspiel zwischen Propaganda, amtlicher Zensur, Presse und angeblich verführter Öffentlichkeit.[3] Damit werden die Medien in ihren gesellschaftlichen Kontext gestellt. Dabei handelt es sich um eine Fragestellung, die für die Beschäftigung mit den auf den Ersten Weltkrieg folgenden Kriegen und militärischen Auseinandersetzungen zunehmend bedeutsamer geworden ist.
In einem Interview antwortete dazu der Historiker Frank Bötsch auf die Frage, ob die Westalliierten den Ersten Weltkrieg durch den Einsatz moderner Medien gewonnen hätten?
„Die westliche Propaganda war tatsächlich der deutschen überlegen und sie förderte sicherlich die Bereitschaft, trotz großer Verluste und Entbehrungen durchzuhalten. Dass die Westalliierten deshalb den Krieg gewonnen hätten, ist jedoch vor allem eine Wahrnehmung, die in den 1920er-Jahren aufkam. Besonders die Nationalsozialisten glaubten, Deutschland habe wegen der westlichen „Hetzpropaganda“ verloren. Auch Hitler schrieb dazu in „Mein Kampf“, dass künftig Kriege wie in den USA wie Seife verkauft werden müssten. Entsprechend bauten die Nazis ab 1933 die Propaganda massiv aus. Im Zweiten Weltkrieg sollten nun eigene Propagandakompanien mit modernsten Mitteln den Krieg medial bewerben. Vor allem der Film und Illustrierte wurden professionell gestaltet, um nach westlichem Vorbild für den Krieg zu mobilisieren und eine erneute Niederlage zu verhindern. Dabei zeigte sich jedoch rasch, dass Propaganda allein nicht über Siege entscheidet.
(…) Die deutsche Heeresleitung setzte vor allem auf eine scharfe Zensur, auf Anweisungen an die Presse und klassische Printmedien. Diese Gängelung entsprach aber nicht mehr der modernen Medienwelt. In Großbritannien und den USA entstanden stattdessen kommerzielle emotionale Filme, die Front und Heimat miteinander verbanden. Sie zeigten Einzelschicksale, etwa über Frauen und Kinder in Belgien, die den barbarischen deutschen Soldaten in die Hände fielen. Dies mobilisierte Soldaten und die „Heimatfront“ für den Krieg. In Deutschland wurden dagegen kaum Filme gefördert.“[4]
Gegenwärtig, da die mediale Durchdringung der gesellschaftlichen Beziehungen noch wesentlich umfassender geworden ist, wird es geradezu zu einer Notwendigkeit, sich den Versuchen zum systematischen Ausschluss von Wahrheit und Kritik aus den öffentlichen Debatten, wie sie gerade in den letzten Jahren und Monaten offensichtlich geworden (Irak-Krieg, NSA-Affaire) sind, zu widersetzen.
[1] Bernd Kleinhans: Der Erste Weltkrieg als Medienkrieg: Wochenschau, Spielfilm und Propaganda zwischen 1914 und 1918. In:
{2] Kleinhans; a.a.O.
So auch Prof. Dr. Gerhard Hirschfeld in seinem Ankündigungstext zum Vortrag bei der fachdidaktisch Tagung im Februar: http://wordpress.nibis.de/geschichte-politik/vortraege/. Siehe dazu auch den Beitrag in diesem Tagungsband.
In der Literatur wird teilweise bereits der Krimkrieg als „Medienkrieg“ gewertet: „Chloroform, Telegraphie, Dampfschiffe und Präzisionsgewehre gehörten zu den „modernen“ Merkmalen des Krimkriegs (1853–1856). Da er auch von zahlreichen Presse-Berichterstattern, Illustratoren und Photographen beobachtet wurde, die ihre Text- oder Bildreportagen postwendend ans Heimatpublikum sandten, kann er auch als erster Medienkrieg der Geschichte gelten. Die modernen Kommunikationstechniken erlaubten die nahezu simultane Übermittlung der Ereignisse, die Reportage war also nicht mehr nachträgliche Aufzeichnung abgeschlossener Prozesse, sondern griff gestaltend in das Geschehen ein. Um Illustratoren und Korrespondenten zufriedenzustellen, wurde sowohl das militärische als auch das zivile Kriegsgeschehen von den Verantwortlichen sorgsam inszeniert, was den Krimkrieg ästhetisch attraktiv, wenn nicht spektakulär machte.“ (http://ieg-ego.eu/de/threads/europaeische-medien/europaeische-medienereignisse/das-bild-des-krieges-der-krimkrieg-185320131856-krimkrieg-be-freigabe
[3] Vgl. Klaus-Jürgen Bremm: Propaganda im Ersten Weltkrieg, Darmstadt 2013
[4]Der Beginn des modernen Medienkrieges. Interview mit Frank Bötsch (http://www.pnn.de/campus/832627/)