Ökonomische Kompetenz
 Bild: Pixabay
Bild: Pixabay
Ökonomie: Ein gesellschaftliches Projekt
Detlef Endeward (08/2025)
Grundgedanke dieser Überlegungen ist: Ökonomische Gesetze sind keine Naturgesetze, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse und Ideologien. Wirtschaftliches Handeln ist demzufolge nicht naturgegeben, sondern geprägt durch Macht- und Herrschaftsinteressen.
Wenn Ökonomie die materielle Grundlage für gesellschaftliches Leben ist, beduetet dies, dass es von existenzieller Bedeutung ist, wie die Ökonomie einer Gesellschaft verfasst ist, wer welchen Einfluss auf ökonomische Entwicklung hat. Demokratie, d.h. Partizipation muss sich auch auf die Sphäre der Ökonomie beziehen, sonst kann sich eine Gesellschaft nicht demokratisch nennen. Ein vertieftes Verständnis für gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge erfordert es, politische und ökonomische Aspekte verknüpft zu denken. Das bedeutet, das ökonomische Kompetenz und politische Kompetenz die Basiskompetenzen im Modells darstellen.
Ökonomisches Lernen beinhalte zwei Perspektiven und eine konkrete Utopie:
Wirtschaftsordnungskompetenz
Auf der strukturellen Ebene muss ökonomisches Lernen dazu beitragen, die Funktionslogik des ökonomischen Systems zu begreifen. Das beinhaltet die Fähigkeit, ökonomische Strukturen, Machtverhältnisse und institutionelle Rahmenbedingungen zu verstehen und kritisch einzuordnen.
Handlungskompetenz im Wirtschaftlichen
Das beinhaltet die praktische Fähigkeit, ökonomische Zusammenhänge auf die eigene Lebenswelt zu beziehen und reflektierte Entscheidungen zu treffen.
Alternativen entwickleln
Diese doppelte Persspektive schließt die Kritik an der herrschenden marktzentrierten Ökonomie als ideologisch verzerrt ein und stellt die Forderung nach einer alternativen, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsweise auf. Ökonomische Kompetenz bedeutet hier, zwischen konkurrierenden Logiken zu unterscheiden und gesellschaftliche Reformen aktiv mitzugestalten
Das Kompetenzmodell von Oskar Negt
Philosophische Kompetenz
Werturteilsbildung und Reflexionsfähigkeit
Kulturelle Kompetenz
Ästhetisches Bewusstsein und Kreativität
Poltische Kompetenz/Demokratiekompetenz
Rechtsbewusstsein und Partizipationsfähigkeit
Soziale Kompetenz/Identitätskompetenz
Identitätsbewusstsein und authentische Handlungsfähigkeit
Interkulturelle Kompetenz
Kommunikative Kompetenz
Medienkompetenz
Mediealitätsbewusstsein und (selbst)kritische Handhabungskompetenz
Technologische Kompetenz
- Solidarische Ökonomie
Gerechtigkeitskompetenz
Sensibilität für Enteignungserfahrungen und Wahrnehmungsfähigkeit von Ungerechtigkeit
Ökologische Kompetenz
Nachhaltigkeitsbewusstsein und poltisches Engagement
Historische Kompetenz
Geschichtsbewusstsein und Utopiefähigkeit
Ein Bildungskonzept der Komplexitätsfähigkeit
Gesamtsicht auf die Dimensionen
Die Lernwerkstatt im Konzept der Gesellschaftskompetenzen
Literatur
Ökonomische Kompetenz im Kontext des Gesellschaftskompetenzmodells
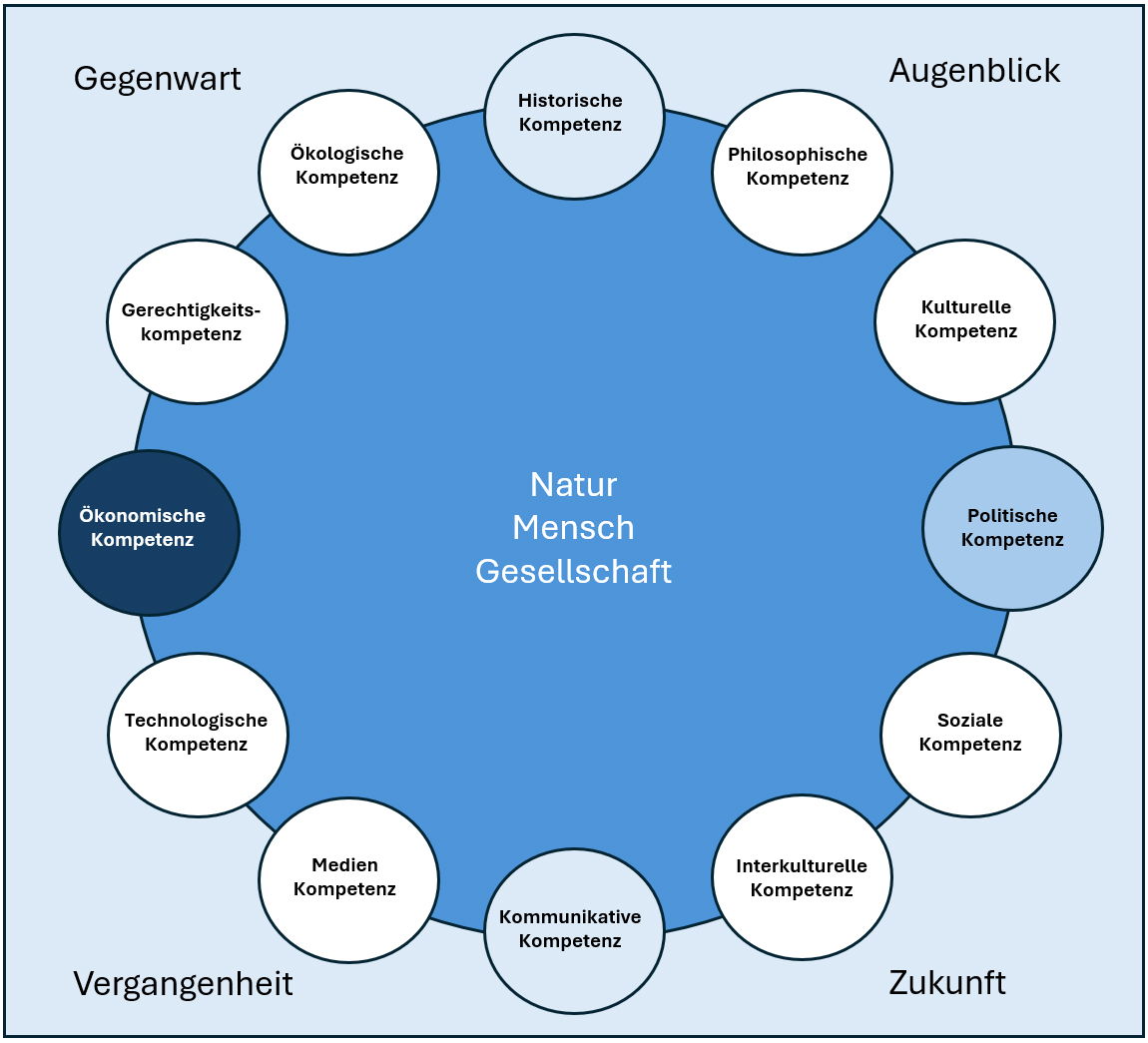
Ökonomische Kompetenz im Kontext des Gesellschaftskompetenzmodells bedeutet, wirtschaftliche Zusammenhänge als gesellschaftlich geprägte Prozesse zu verstehen. Sie basiert auf der Erkenntnis, dass ökonomische Regeln keine Naturgesetze sind, sondern Ausdruck von Machtverhältnissen und Ideologien. Ziel ist es, die Funktionslogik des Wirtschaftssystems zu durchdringen und ökonomische Entwicklungen kritisch zu reflektieren. Demokratische Teilhabe muss auch die ökonomische Sphäre umfassen. Ökonomisches Lernen fördert die Fähigkeit, wirtschaftliche Entscheidungen in Bezug zur eigenen Lebenswelt zu setzen und politische sowie ökonomische Aspekte verknüpft zu denken


