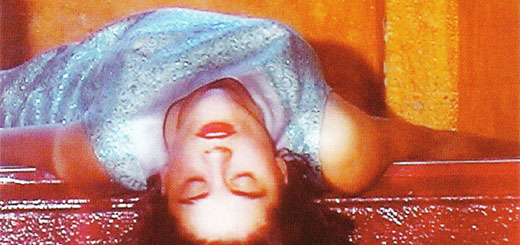Massenmedien und Risikogesellschaft
Risikokommunikation – ein Thema für die Medienpädagogik?
Wolf-Rüdiger Wagner (1994)
Noch haben wir uns nicht an die Programmausweitung durch Kabel- und Satellitenfernsehen gewöhnt, da steht bereits der nächste rasante Entwicklungsschub ins Haus: Ab 1995, so kann man überall lesen, werden mit Hilfe neuer Satelliten und einer optimierten Übertragungstechnik 200 Programme und mehr ins TV-Netz eingespeist.
Angesichts der desorientierenden Vielzahl von Programmen, angesichts der Explosion von Gewalt auf den Bildschirmen, angesichts des quotentreibenden Voyeurismus, dem kein Leiden und Sterben echt genug sein kann, angesichts dieser drängenden Probleme unserer Kommunikationskultur, mag es manchem als ein Ausweichen in alltagsferne akademische Diskussionen erscheinen, wenn sich Medienpädagogen mit dem Thema „Massenmedien und Risikokommunikation“ befassen. Doch abgehoben von den aktuellen Fragen der Medienpädagogik ist dieses Thema nur auf den ersten Blick.
Die „Niedersächsischen Tage der Medienpädagogik“ vom 25. bis 27. Oktober 1993 in Leer standen unter der Thematik „Medien: Warner oder Angstmacher?“. Dieses Thema wurde gewählt, weil eine Diskussion über „Medien und Gewalt“ zu kurz greift, wenn man sich ausschließlich auf die Gewaltdarstellungen in den Medien konzentriert. Medien wirken vermittelter, unter Umständen aber nachhaltiger auf das gesellschaftliche Klima – und damit auch auf die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden bzw. Gewaltanwendung zu akzeptieren – ein, indem sie unser Lebensgefühl, unser Problembewusstsein und unsere Einstellung zur Zukunft beeinflussen Diesem Einfluss der Medien kann man nicht durch Appelle zur Medienabstinenz entgegenwirken.
In der Diskussion über die Mediengesellschaft ist oft die Rede vom „Verschwinden der Wirklichkeit“. Verbunden wird damit die Vorstellung, die Medien stellten sich zwischen uns und die Wirklichkeit, der Konsum der Bildschirmsurrogate trete an die Stelle unmittelbarer, direkter Erfahrungen.
Da sich diese Diskussion sehr stark auf den Medienkonsum im Unterhaltungs- und Freizeitbereich konzentriert, gerät dabei eine andere Entwicklung nicht in den Blick. In hochkomplexen Industriegesellschaften mit ihren weltweiten Verflechtungen und angesichts der globalen Langzeitfolgen wissenschaftlich-technischer Eingriffe in unsere Umwelt liegen viele Probleme außerhalb unseres unmittelbaren Erfahrungshorizonts.
Am augenfälligsten wird die Entwertung unserer sinnlichen Wahrnehmung und unserer eigenen Erfahrungen im Bereich der Ökologie. Die neuartigen Umweltrisiken und die Auswirkungen von Eingriffen in komplexe Systeme entziehen sich dem unmittelbaren menschlichen Wahrnehmungsvermögen. Wir nehmen diese Risiken nur noch vermittelt durch die Medien wahr.
Der Anteil der auch für den einzelnen wichtigen Entwicklungen und Ereignisse, die sich außerhalb des unmittelbaren Wahrnehmungs- und Erfahrungshorizontes abspielen, wird immer größer, und damit wird zwangsläufig der Anteil medial vermittelter Informationen an unserem „Weltwissen“ immer bedeutender.
Wenn wir zunehmend auf Medien als „gesellschaftliche Wahrnehmungsorgane“ angewiesen sind, mag damit eine Entwertung unserer Alltagserfahrungen einhergehen. Dies liegt dann jedoch nicht an den Medien, sondern an den „unüberschaubaren“ Verhältnissen.
Ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit traten diese Fragen während der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Der Schauplatz dieser Katastrophe lag weit weg, und die Folgen der Katastrophe entzogen sich unserer sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeit. Eindringlicher und beklemmender konnte uns unsere Abhängigkeit von den Medien nicht vor Augen geführt werden.
Wenn „Wirklichkeit“ bei der Vermittlung durch die Medien zwangsläufig und notwendigerweise einen Auswahl- und Gestaltungsprozess durchläuft, dann müssen wir in die Lage versetzt werden, die Muster, nach denen Wirklichkeit in den Medien konstruiert und inszeniert wird, zu durchschauen, und uns andererseits damit beschäftigen, wie wir diese Wirklichkeitskonstrukte wahrnehmen und wie wir an diesen Konstrukten selbst weiterarbeiten.
Damit die Medienpädagogik sich dieser Herausforderung stellen kann, muss sie sich mit dem Diskussionsstand in anderen Wissenschaftsdisziplinen vertraut machen: Daher stand das in dieser Broschüre abgedruckte Referat zum Thema „Massenmedien und Risikogesellschaft“ am Anfang der „Niedersächsischen Tage der Medienpädagogik“ in Leer. In den anschließenden Workshops wurden weitere Aspekte des „Kriegs-, Krisen- und Katastrophenjournalismus“ gemeinsam mit Wissenschaftlern und Journalisten diskutiert. Veröffentlichungen zu einzelnen Workshops werden die Dokumentation dieser Tagung abrunden.
Mit dem Thema „Risikokommunikation“ werden Fragen der „Wirklichkeitskonstruktion“ in den Massenmedien angeschnitten. Das Thema „Medien: Warner oder Angstmacher?“ ist für die Medienpädagogik jedoch noch aus einer anderen Perspektive von zentraler Bedeutung. Medien beeinflussen die „Stimmungslage der Nation“, sie beeinflussen aber auch die individuelle Befindlichkeit der Medienkonsumenten. Zu dem offensichtlichen Zusammenhang von „Wirklichkeitskonstruktion in den Medien“, individuellen Strategien der Informationsverarbeitung und der Angstbewältigung einerseits und der individuellen Mediennutzung andererseits einige abschließende Bemerkungen.
Für Medienkritiker wie Neil Postman ist die Sache klar: Schuld an der unaufhaltsamen Trivialisierung unserer Kultur ist das Medium Fernsehen an sich. Diese Art von Medienkritik lässt völlig außer Acht, auf welchen ökonomischen, sozialen und psychologischen Grundlagen der Erfolg der Trivialsendungen des Fernsehens beruht. (1)
Geht man den Wechselwirkungen zwischen Publikum und Programm nach, so stößt man auch da sehr schnell auf das Thema „Risikogesellschaft“. Dies wird deutlich, wenn man sich folgenden Sachverhalt vergegenwärtigt:
„Kennzeichen der Risikogesellschaft ist nicht unbedingt die Größe der uns umgebenden Gefahren, denen Menschen ja immer schon – und wie sich aus der Verlängerung der Lebensdauer ablesen lässt: früher vielleicht stärker als heute – ausgesetzt waren. Als charakteristisches Merkmal der Risikogesellschaft wird vielmehr angeführt, daß Gefahren zunehmend nicht mehr als unbeeinflußbar hingenommen, sondern als kalkulierbar und gestaltbar problematisiert werden.“ (2)
Risiken, die mit meiner Lebensführung in Verbindung stehen, könnte ich – zumindest im Prinzip – minimieren. Allerdings muss ich mich dabei oftmals zwischen konkurrierenden Erklärungs- und Lösungsansätze entscheiden. Je existentieller das Risiko, desto mehr Stress und Unsicherheit: Habe ich mich für das richtige Erklärungsmodell entschieden, gibt es irgendwo eine bessere, mir nicht bekannte Therapie? Daneben tauchen jedoch zunehmend Risiken auf, die zwar offensichtlich von Menschen verursacht sind, bei denen ich als Individuum aber keine Möglichkeit sehe, die Gefahr abzuwenden. Nachrichten über das „Ozonloch“, das „Waldsterben“ oder den „Wahnsinn in Bosnien“ führen mir meine Ohnmacht Tag für Tag vor Augen.
Starker Medienkonsum korreliert nach vielen Untersuchungen mit hohem persönlichem und sozialem Stress, mit einem Mangel an Selbstwertgefühl und der Vorliebe für Fernsehprogramme, die Probleme vergessen lassen. Vielseher scheinen demnach Informationen gezielt zu vermeiden und stattdessen stereotype Unterhaltungsprogramme auszuwählen. Offen bleibt der Wirkungszusammenhang: Vielseher könnten ihr „Weltbild“ aus der negativen Medienwirklichkeit abgeleitet haben; bei ihrem Fernsehkonsum könnte es sich aber auch um einen Rückzug aus der negativ erlebten Wirklichkeit handeln.
Da es sich in beiden Fällen um einen sich gegenseitig verstärkenden Prozess handelt, ist es medienpädagogisch wichtig, der Frage nachzugehen, inwieweit Medien durch die Auswahl und vor allem durch die Art der medienübergreifenden Inszenierung und Dramatisierung von Problemen und Risiken dazu beitragen, Unsicherheitsgefühle und Zukunftsängste in der Bevölkerung zu verstärken. Derartige Stimmungslagen wirken sich nicht nur auf Programmpräferenzen aus, sondern können sehr konkrete Auswirkungen auf das gesellschaftliche und politische Verhalten und damit verbunden auch auf die Bereitschaft, Gewalt als Mittel zur Lösung von Konflikten zu tolerieren, haben.
Manches spricht also dafür, dass man mit dem Thema „Risikokommunikation“ näher an dem Zusammenhang von „Medien, Gewalt und Gewaltbereitschaft“ dran ist, als manche aufgeregte und vordergründige Diskussion über die Anzahl von Bildschirmtote
Hans PeterPeters: Massenmedien und Risikogesellschaft. Dokumentation ,,Medien – Warner oder Angstmacher?“ Nr. 1, Hannover 1994