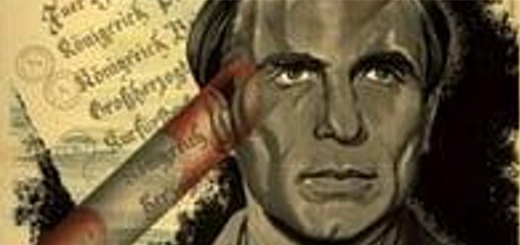Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Vergangenheit
Die Vergangenheit in der Gegenwart
Nachkriegsfilme als Spiegel gesellschaftlicher Erinnerung
Detlef Endeward (06/2025)
Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit war in der unmittelbaren Nachkriegszeit ein zentrales, zugleich aber auch konfliktreiches Thema des deutschen Spielfilms. Die Seite „Die Vergangenheit in der Gegenwart“ der Lernwerkstatt Film und Geschichte widmet sich diesem Spannungsfeld und stellt Filme vor, die zwischen 1946 und 1950 entstanden und unterschiedliche Strategien im Umgang mit der jüngsten Vergangenheit offenbaren.
Im Zentrum steht die Frage, wie der Faschismus filmisch erinnert, verdrängt oder umgedeutet wurde. Während die DEFA in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) früh eine antifaschistische Traditionslinie etablierte – etwa mit Die Mörder sind unter uns (1946) oder Rotation (1949) – dominierten in der westdeutschen Nachkriegsproduktion narrative Muster der Entlastung und Selbstviktimisierung (vgl. Fritsche, 2003). Filme wie In jenen Tagen (1947) oder Zwischen gestern und morgen (1947) thematisieren zwar die NS-Zeit, rücken aber häufig individuelle Schicksale in den Vordergrund und vermeiden eine systematische Auseinandersetzung mit Schuld und Verantwortung.
Diese Beobachtungen werden durch die Arbeit von Detlef Kannapin (Dialektik der Bilder, 2005) vertieft. In seiner vergleichenden Studie analysiert Kannapin die filmische Vergangenheitsbewältigung in BRD und DDR zwischen 1945 und 1990. Er betont die widersprüchliche Beziehung zwischen Film und Geschichte, in der Filme einerseits zur Aufklärung beitragen können, andererseits aber auch zur Mythenbildung und Verklärung neigen. Die „Dialektik der Bilder“ besteht laut Kannapin darin, dass filmische Darstellungen der NS-Zeit sowohl entlarvend als auch verfälschend wirken können – je nach Kontext, Intention und Rezeption.
Besonders relevant ist Kannapins Hinweis auf die politische Ikonographie des Nachkriegsfilms: Während die DDR-Filme häufig klare Täter-Opfer-Zuschreibungen vornahmen, tendierten westdeutsche Produktionen dazu, die NS-Zeit als „Schicksalsgemeinschaft“ zu inszenieren – mit einer Betonung auf Leid und Verlust statt auf Verantwortung und Schuld.
Die Lernumgebung greift diese Ambivalenzen auf und versteht Filme nicht als objektive Abbilder, sondern als zeitgebundene Deutungsangebote, die gesellschaftliche Mentalitäten, Ängste und Hoffnungen spiegeln. In Anlehnung an Aleida Assmann (2006), die betont, dass die kollektive Erinnerungskultur in der frühen Bundesrepublik stark von Verdrängung und selektiver Erinnerung geprägt war, wird deutlich, dass Erinnerungskultur nicht statisch ist, sondern sich im Medium Film besonders dynamisch und konflikthaft entfaltet.
Die doppelte Kontextualisierung – Film als Produkt seiner Entstehungszeit und als Beitrag zur Erinnerungskultur – ermöglicht eine multiperspektivische Analyse, die sowohl filmästhetische als auch geschichtsdidaktische Zugänge integriert.
Literatur
- Assmann, Aleida (2006): Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München 2006
- Fritsche, Christiane (2003): Vergangenheitsbewältigung im Fernsehen. Westdeutsche Filme über den Nationalsozialismus in den 1950er und 60er Jahren. München 2003
- Kannapin, Detlef (2005): Dialektik der Bilder. Der Nationalsozialismus im deutschen Film. Ein Ost-West-Vergleich. Berlin 2005
Zentrale Motive im Nachkriegsfilm
Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Vergangenheit
- Der Krieg: Schicksal und menschliches Leid
- Der Holocaust im deutschen Nachkriegsspielfilm
- Politische Verfolgung und Widerstand
- Aus der Geschichte lernen
Probleme der Zeit: Heimkehrergeschichten, Flüchtlingsschicksale, Orientierungsversuche
Filmsatiren/Filmparodien
(Beziehungs)Komödien „vor dem dunklen Hintergrund der Zeit“
Liebesdramen/Gesellschaftsdramen
Kindheit und Jugend
Kriminalfilm
Historienfilme/Literaturverfilmungen