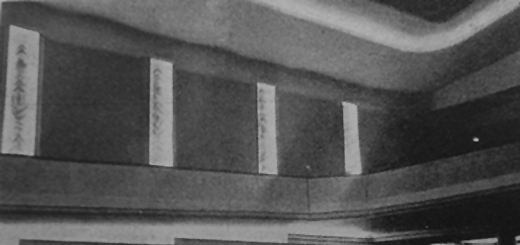Der Holocaust im deutschen Nachkriegsspielfilm
 Filmszene aus LANG IST DER WEG
Filmszene aus LANG IST DER WEG
Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust fand in den zwischen 1945 und 1949 entstandenen deutschen Filmen in sehr unterschiedlicher Form statt, sowohl in den DEFA-Filmen als auch in den westlichen Produktionen. Dazu zwei Einschätzungen:
Vielfach besteht der Eindruck, die Nachkriegszeit sei vor allem durch das Beschweigen der jüngsten Vergangenheit geprägt gewesen. Doch in den Jahren unmittelbar nach Ende des Interner Link:2. Weltkriegs sind in Deutschland einige Filme entstanden, die sich mit der Verfolgung und Vernichtung der Jüdinnen und Juden in Europa befassten und in diesem Kontext von jüdischer Erfahrung erzählten: Der von Fritz Kortner geschriebene Film DER RUF (1949, Regie: Josef von Baky) über die Remigration eines Professors, der sich mit dem Antisemitismus der Nachkriegszeit auseinandersetzen muss und daran letztlich stirbt, zeigt nicht nur ein Panorama der Perspektiven von Exilant*innen und die Mehrsprachigkeit des Exils, sondern auch die Schattierungen von Täter*innen- und Mitläufer*innenschaft in Deutschland – wobei sich das tragische Ende im internationalen Verleihtitel THE LAST ILLUSION weitaus stärker andeutet; auch der von Artur Brauner produzierte Film MORITURI (1948, Regie: Eugen York) über eine Gruppe im Wald Versteckter am Ende des 2. Weltkriegs sei hier erwähnt; ebenfalls der DEFA-Film EHE IM SCHATTEN (1947, Regie: Kurt Maetzig), in dem angelehnt an die Geschichte Joachim und Meta Gottschalks von einem Schauspieler*innenehepaar erzählt wird, das sich der fortschreitenden Verfolgung und drohenden Deportation der jüdischen Frau nur durch den gemeinsamen Suizid entziehen kann; oder schließlich die jiddischsprachige Produktion LANG IST DER WEG (1947/48, REGIE: Herbert B. Fredersdorf, Marek Goldstein), die jüdische Überlebende im Transit eines DP-Camps zeigt – um nur einige Beispiele zu nennen.
Nationalsozialismus, Krieg und Massenmord werden trotz der Fluchtbewegungen ins Private thematisiert, doch vermitteln die Filme vor allem ein Bild von den Deutschen als Schicksalsgemeinschaft. Das, was wir heute Holocaust nennen, also der staatlich organisierte und von Deutschen ausgeführte bzw. akzeptierte Mord an den Juden, wird in diesen Filmen zwar erwähnt, allerdings nicht erklärt und nicht dargestellt. In manchen Filmen erscheinen Nazi-Diktatur, Krieg und Holocaust als Gesamtkatastrophe, die über die Menschheit gekommen ist. Die Unterschiede zwischen Tätern, Opfern und Mitläufern verschwimmen. (S. 92)
(..)
In immerhin neun Nachkriegsfilmen von insgesamt siebenundvierzig zwischen Mai 1945 und Dezember 1948 entstandenen Produktionen gibt es jüdische Figuren und werden Antisemitismus und Verfolgung thematisiert. Zu einem großen Teil ist das auf die Initiative jüdischer Überlebender wie Israel Becker, Artur Brauner oder Fritz Kortner zurückzuführen oder auf die besondere Förderung dieser Projekte durch engagierte Filmpolitiker unter den Alliierten. Erfolgreich waren diese Filme um so mehr, als sie eindeutige Identifikationsangebote mit den unschuldigen Opfern oder heldenhaft Widerstand Leistenden anboten. Die noch so vorsichtig gestellten Fragen nach Schuld und Verantwortung aber wollten die meisten Zuschauer nicht hören. Sie störten wie im Fall von Morituri die Aufführung – oder gingen gar nicht erst ins Kino. (S. 94)
aus: Martina Thiele: Publizistische Kontroversen über den Holocaust im Film. Dissertation an der Georg-August-Universität zu Göttingen, Göttingen 2001
Bis Ende 1949 wurden insgesamt deutsche 84 Spielfilme uraufgeführt. Davon werden in Filme die Verfolgung und Vernichtung von Jüdinnen und Juden aus unterschiedlicher Perspektive direkt themtisiert oder gibt es Motive, die den Antisemitismus ansprechen: (1)
- Weiter-Leben nach dem Terror
LANG IST DER WEG (1947/48) – MORITURI (1948) – DER RUF - Selbstmord als Folge des Verfolgungsdrucks
IN JENEN TAGEN (Episode 3) – EHE IM SCHATTEN (1947) – ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN AFFAIRE - Folge kapitalistischer Produktionsweise
UNSER TÄGLICH BROT (1949) – RAT DER GÖTTER (1950) - Folge deutschnationaler und antidemokratischer Gesinnung
DIE BUNTKARRIERTEN – AFFAIRE BLUM – ROTATION
Die jeweiligen Perspektiven, aus denen die Geschichten erzählt werden und die Erzählweisen sind trotz thematischer Ähnlichkeit sehr verschieden. Siehe dazu ausführlich die Darstellungen zu den einzelnen Filmen. Die Reaktionen des Kinopublikums waren dagegen ziemlich einheitlich selten positiv: viele Filme wurden schlicht ignoriert, einige offen boykotiert.
Eine Auseinandersetzung mit diesen Filmen ist auch heute noch in zweifacher Hinsichtlohnend:
- Als filmische Geschichtserzählung erinnern sie an das Grauen des faschistischen Terrors und das Leid der Verfolgten und liefern uns Stellungnahmen von Menschen, die diese Verbrechen gerade erst erleben mussten und überlebt haben oder aber davon gewusst haben mussten.
- Im Kontext mit den zeitgenössischen Reaktionen auf diese Filme – in der Filmkritik und beim Kinopublikum – erfahren wir etwas über die Mentalität der Menschen, über ihre Bereitschaft oder ihr Unvermögen sich mit dieser Vergangeneheit und ihrer Schuld auseinanderzusetzen.
Und letztlich sind diese Film heute Filme gegen das Vergessen?
Grundlagen
Autorengruppe Nachkriegsspielfilme: Spielfilme der Nachkriegszeit als Quelle ihrer Gegenwart. (unveröffentl. Manuscript 1992)
Tim Gallwitz: „Was vergangen ist, muss vorbei sein!“. Zur Gegenwärtigkeit des Holocaust im frühen deutschen Nachkriegsfilm 1945-1950. In: Die Vergangenheit in der Gegenwart. Konfrontationen mit den Folgen des
Holocaust im deutschen Nachkriegsfilm. Hrsg. vom Deutschen Filminstitut-DIF e.V., Frankfurt am Main 2001
Cilly Kugelmann: Lang ist der Weg. Eine jüdisch-deutsche Film-Kooperation. In: Fritz Bauer Institut (Hg.): Jahrbuch 1996 zur Geschichte und Wirkung des Holocaust, Frankfurt a. M. 1996, S. 353-370
Martina Thiele: Publizistische Kontroversen über den Holocaust im Film. Dissertation an der Georg-August-Universität zu Göttingen, Göttingen 2001