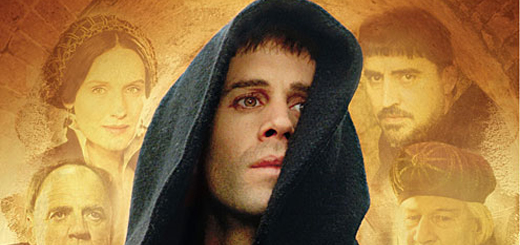Film als Seismograph und Medium kultureller Hegemonie
Kracauer und Gramsci im Dialog
Die theoretische Verbindung von Siegfried Kracauers berühmtem Werk Von Caligari zu Hitler (1947) mit Antonio Gramscis Konzept kultureller Hegemonie eröffnet ein fruchtbares analytisches Feld für das Verständnis der kulturellen Dynamiken der Weimarer Republik und des Faschismus in Deutschland. Beide Ansätze gehen davon aus, dass politische Herrschaft nicht allein auf offener Gewalt und institutioneller Macht beruht, sondern in einem dichten Netz kultureller Praktiken, Symbole und kollektiver Mentalitäten verankert ist. Während Gramsci den theoretischen Rahmen bietet, um Herrschaft als ein Zusammenspiel von Zwang und Konsens zu begreifen, liefert Kracauer eine methodische Perspektive auf die konkrete Rolle der Filmkultur als „Seismograph“ gesellschaftlicher Dispositionen.
Kracauers Ansatz: Film als „Seismograph“
Kracauer vertritt die These, dass Filme – gerade die scheinbar „unpolitischen“ Unterhaltungsfilme – tiefere gesellschaftliche Wahrheiten über die kollektive Psyche einer Epoche sichtbar machen. Filme sind demnach keine neutralen Produkte, sondern „Seismographen“ für latente Strukturen: verdrängte Ängste, unterschwellige Sehnsüchte und unausgesprochene Konflikte. In der deutschen Filmproduktion der Weimarer Zeit erkennt er die Vorbereitung autoritärer Mentalitäten, die später in den Faschismus mündeten. So interpretiert er etwa Das Cabinet des Dr. Caligari (1920) als Allegorie auf die Bereitschaft zur Unterordnung unter autoritäre Herrschaft: Der wahnsinnige Hypnotiseur Caligari steht für das Führerprinzip, während die Figuren sich seiner Kontrolle fügen.
Auch andere Genres deutet Kracauer als Indikatoren einer kollektiven Mentalität: Die Berg- und Naturfilme von Arnold Fanck oder Leni Riefenstahl inszenierten den Kult der Führergestalt, Opferbereitschaft und Gemeinschaft in der Überwindung der Natur – Motive, die nahtlos in die NS-Ideologie integriert werden konnten. Gleichzeitig spielten leichte Komödien und eskapistische Melodramen eine nicht minder wichtige Rolle, weil sie die Erfahrung von Krise und Unsicherheit verdrängten und das Publikum in eine „heile Welt“ entführten. Für Kracauer war dies keine harmlose Unterhaltung, sondern Teil einer kulturellen Normalisierung, die die Gesellschaft anpassungsfähig und unkritisch machte.
Gramscis Perspektive: Kulturelle Hegemonie
Gramsci entwickelt das Konzept der kulturellen Hegemonie als zentrale Dimension von Herrschaft im Kapitalismus. Herrschaft beruht demnach nicht ausschließlich auf staatlichem Zwang, sondern auf der aktiven Zustimmung breiter Gesellschaftsschichten zu den Deutungen, Werten und Normen der herrschenden Klasse. Diese Zustimmung wird in den Institutionen der Zivilgesellschaft – Schulen, Kirchen, Medien, Vereinen, aber eben auch im Kino – erzeugt und reproduziert. Kultur ist für Gramsci somit nicht bloß „Überbau“, sondern ein aktives Feld des Klassenkampfes, in dem sich entscheidet, ob eine bestimmte Formation ihre Legitimität sichern kann.
Besonders betont Gramsci die Fähigkeit hegemonialer Blöcke, auch widersprüchliche oder oppositionelle Elemente zu integrieren. Subkulturelle Praktiken, Gegenbewegungen oder avantgardistische Ästhetiken können, wenn sie in hegemoniale Narrative eingebettet werden, zur Stabilisierung der herrschenden Ordnung beitragen.
Verbindung: Film als Medium der hegemonialen Vorarbeit
Setzt man Kracauers und Gramscis Perspektiven in Beziehung, so lässt sich Film als zentrales Medium der hegemonialen Vorarbeit verstehen. Die in Weimar populären Filmgenres boten ein kulturelles Reservoir, das später vom NS-Regime aufgegriffen und in seine Volksgemeinschafts-Ideologie integriert werden konnte. Kracauers „Seismographen“-Metapher beschreibt genau jenen Prozess, den Gramsci als Aufbau von Hegemonie fasst: unscheinbare, alltägliche kulturelle Praktiken erzeugen langfristig Dispositionen, die politische Projekte anschlussfähig machen.
So lässt sich etwa die Popularität der Bergfilme „gramscianisch“ deuten: Sie transportierten Werte wie Gemeinschaft, Opfer, Naturmystik und Führerverehrung, die zwar in einem scheinbar unpolitischen Kontext präsentiert wurden, jedoch die Akzeptanz autoritärer Muster vorbereiteten. Das Kino fungierte hier als „Übersetzungsinstanz“, die zwischen diffusen gesellschaftlichen Sehnsüchten und hegemonialer Ideologie vermittelte.
Ebenso zeigt sich, dass auch Eskapismus eine hegemoniale Funktion hat: In Gramscis Begriffen handelt es sich um eine Form des „passiven Konsenses“. Indem Filme soziale Krisenerfahrungen ästhetisch verdrängten, trugen sie zur Stabilisierung der bestehenden Verhältnisse bei – nicht, weil sie explizit Propaganda betrieben, sondern weil sie alternative, systemkritische Deutungen unsichtbar machten.
Doppelter Erkenntnisgewinn
Die Kombination von Kracauer und Gramsci erlaubt es, Film sowohl als Indikator gesellschaftlicher Mentalitäten als auch als Instrument hegemonialer Stabilisierung zu begreifen. Filme zeigen, wie tief bestimmte Deutungsmuster bereits in der Gesellschaft verankert sind, und zugleich wirken sie daran mit, diese Muster zu verstärken.
Damit wird deutlich, dass kulturelle Hegemonie nicht erst mit der offenen Machtübernahme der NSDAP beginnt, sondern lange zuvor im kulturellen Feld vorbereitet wurde. Kino und populäre Kultur waren zentrale Orte, an denen sich die Bereitschaft zur Unterordnung, die Sehnsucht nach Gemeinschaft und die Externalisierung sozialer Konflikte einübten – ganz im Sinne einer späteren faschistischen Herrschaftsformation.
Literatur
Kracauer, Siegfried (1984): Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films. (Original 1947), Frankfurt/M. 1984
⁴Antonio Gramsci: Gefängnishefte. Kritische Gesamtausgabe. Hamburg 1991ff., v.a. Heft 13, §17.
Kulturelle Hegemonie Im Kapitalismus
Kulturelle Hegemonie nach Antonio Gramsci
Film als Seismograph und Medium kultureller Hegemonie
Kulturelle Hegemonie im Kaiserreich
Ökonomie, Hegemonie und Zustimmung im Faschismus
Kulturelle Hegemonie im Nachkriegsdeutschland
Kulturelle Hegemonie in der Adenauer-Ära