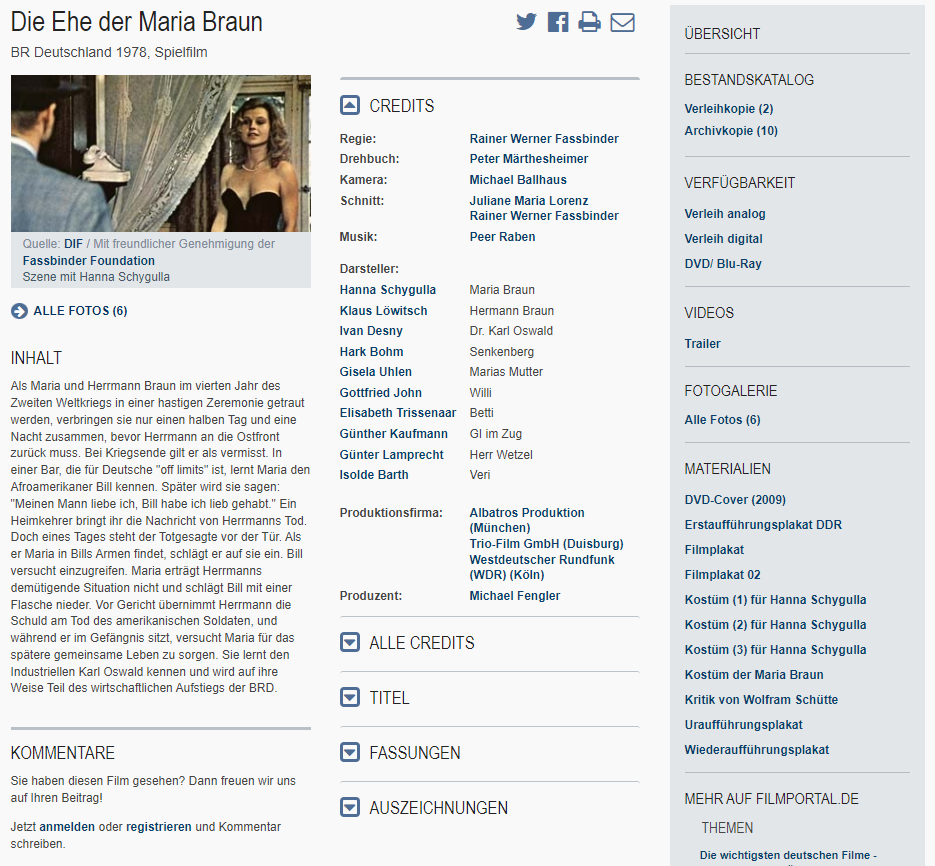Die Ehe der Maria Braun (1978)
Inhalt
Die Ehe der Maria Braun dauerte nur „einen halben Tag und eine ganze Nacht“. Hermann (Klaus Löwitsch), der Ehemann, mußte zurück an die Front. Nach Kriegsende: Maria (Hanna Schygulla) schlägt sich durch, sie arbeitet in einer Bar, in der nur amerikanische Soldaten verkehren. Der Schwarze Bill (George Byrd) wird ihr Liebhaber, sie erwartet ein Kind von ihm. Als Hermann eines Abends wiederkommt, prügelt er auf Maria ein, die mit Bill im Bett liegt. Maria schlägt Bill, der sie verteidigen will, eine Flasche Über den Kopf, er stirbt. Vor Gericht nimmt Hermann die Schuld auf sich. Maria besucht ihn im Zuchthaus, sie will arbeiten „und mit dem Leben fangen wir an, wenn wir wieder zusammen sind“. Nach einer Fehlgeburt lernt Maria den Textilfa-brikanten Karl Oswald (Ivan Desny) kennen. Er erfährt die Geschichte von Hermann. Sie wird Sekretärin, Assistentin, Vertraute und Geliebte von Oswald, der ihr und Hermann nach seinem Tod sein Vermögen vererbt. Als Hermann aus dem Zuchthaus entlassen wird, verpaßt ihn Maria nur knapp. In einem Brief teilt er ihr mit, daß er erst sein eigenes Leben schaffen muß, bevor er zu ihr zurückkehrt. Als Hermann Jahre später zu Maria kommt und mit ihr ein neues Leben anfangen will, erbittet sie sich Bedenkzeit. Sie will sich einen Kaffee kochen, als sie eine Zigarette anzündet, explodiert das ausströmende Gas, eine Explosion jagt alles in die Luft.

| Produktionsland | Deutschland |
| Originalsprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 1979 |
| Länge | 115 Minuten |
| Altersfreigabe | FSK 12 |
| Stab | |
| Regie | Rainer Werner Fassbinder |
| Drehbuch | Peter Märthesheimer, Pea Fröhlich |
| Produktion | Albatros / WDR |
| Musik | Peer Raben |
| Kamera | Michael Ballhaus |
| Schnitt | Rainer Werner Fassbinder (als Franz Walsch), Juliane Lorenz |
|
DarstellerInnen |
|
|
|
Maria – eine Kinofigur, die in sich sehr komprimiert Wünsche, Eigenschaften und Sehnsüchte von Zuschauern verkörpert
Die Maria ist sicherlich keine realistische Figur, sondern etwas, was man gemeinhin eine Kinofigur nennt. Darunter verstehe ich eine Figur, die in sich sehr komprimiert Wünsche, Eigenschaften und Sehnsüchte von Zuschauern verkörpert. Man kann sagen, sie ist mutig und zielstrebig, sie ist eine, die sich voll auf ihre -Gefühle verläßt, und die dabei keine Transuse ist, sondern eine hochhandlungsfähige, schlaue, geschickte und realitätsbewusste Person, die trotz alledem an ihren Gefühlen festhält. Am Schluß kehrt die Kinofigur sozusagen auf den Boden dieser Erde zurück. Und da merkt sie, daß am Himmel nicht nur Schäfchenwolken sind, daß die Sonne ebenfalls trübe verhangen scheint, daß die Erde ziemlich krumm und bucklig ist. Da sagt sie sich: Wenn das so ist dann mach ich Schluß mit dieser Welt. Sie sagt das sehr pathetisch. Was hat si sonst an Möglichkeiten, nachdem sie so hoch balanciert hat? Im Drehbuch hat sie einen realistischen Autounfall selbst herbeigeführt, im Film einen Gasunfall. Das Pathos in dem Maria neunzig Minuten lang gelebt hat, wird in diesem Augenblick den realen Umständen konfrontiert. Nun finde ich wichtig, daß die Person Maria trotz alledem Recht hat; daß sie auch noch Recht hat, wenn sie sich auf diese Weise von der Welt verabschiedet. Aber sie hat auch Recht mit der Art und Weise gehabt, wie sie ihr Leben geführt hat. Sie verweigert es, leicht zu leben«
(Aus dem Presseheft zum Film)
Geschichten von Hoffnungen und Wünschen, von Illusionen und zerstörten Gefühlen
Filmvergleich 1: UND ÜBER UNS DER HIMMEL und UNSER TÄGLICH BROT
Suchende Männer – verbindliche Werte und Perspektiven für das Leben
Filmvergleich 2: DIE EHE DER MARIA BRAUN und RAMA DAMA
Starke Frauen – Sehnsüchte und Illusionen des Alltags
Filmvergleich 3:
Geschichte ist Gegenwart, Gegenwart wird Geschichte.
Hier der vollständige Text
Detlef Endeward: Geschichten von Hoffnungen und Wünschen, von Illusionen und zerstörten Gefühlen. Nachkriegsgesellschaft als Gegenwart und Geschichte im Film. Ursprünglich in: FWU Magazin 1-2/1995, S. 21-28
als Word und pdf
Hier der vollständige Text
Detlef Endeward: Geschichten von Hoffnungen und Wünschen, von Illusionen und zerstörten Gefühlen. Nachkriegsgesellschaft als Gegenwart und Geschichte im Film. Ursprünglich in: FWU Magazin 1-2/1995, S. 21-28
als Word und pdf