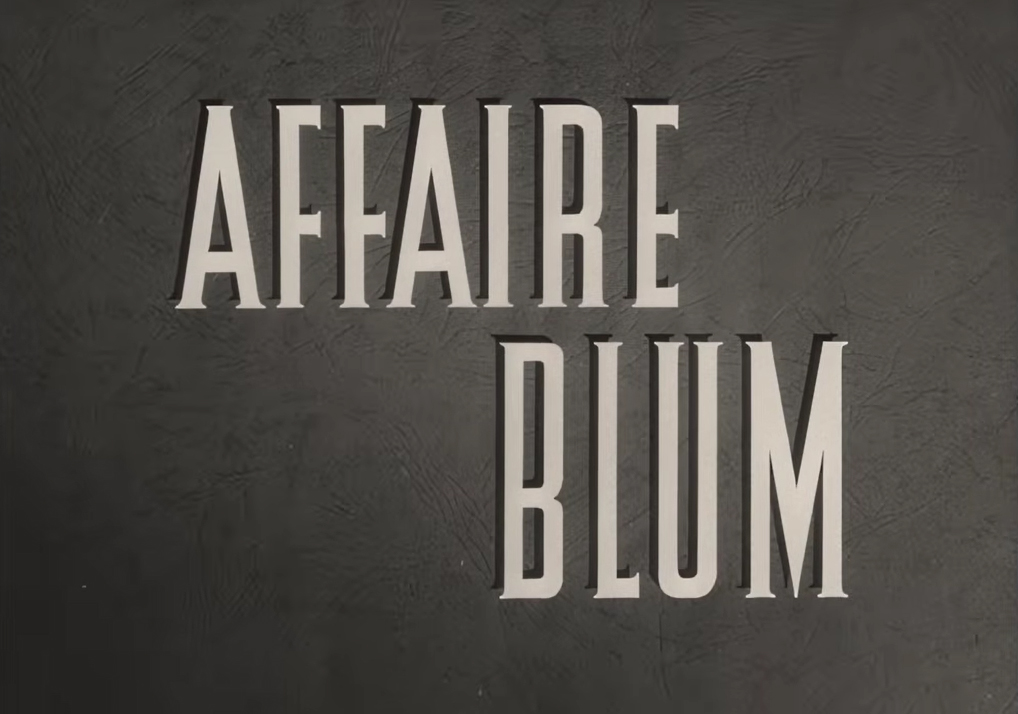Der Film beginnt mit der Ermordung des Buchhalters Platzer durch Karl-Heinz Gabler, einen arbeitslosen ehemaligen Freikorpsmann. Dieser wird kurze Zeit später bei dem Versuch, mit einem Scheck Platzers in einem Waffengeschäft zu zahlen, von Kriminalkommissar Schwerdtfeger verhaftet. Der Polizeibeamte behandelt Gabler aufgrund seiner Freikorpsvergangenheit – auch Schwerdtfeger war Freikorpsmann – bevorzugt. Gabler macht sich den vorhandenen Verdacht Schwerdtfegers, dass das Verschwinden Platzers mit angeblichen Steuerhinterziehungen in der Firma des Juden Dr. Blum in Zusammenhang steht, zunutze und belastet diesen. Blum wird verhaftet und im Gegensatz zu Gabler wie ein Schwerverbrecher behandelt. Schwerdtfeger und Landgerichtsrat Konrad, der die Untersuchung führt, glauben den Ausführungen Gablers nur allzu gern. Landgerichtsdirektor Hecht unterstützt sie in ihrem Vorgehen gegen Blum. Präsident Wilschinsky, der (abweichend vom historischen Fall) mit Blum befreundet ist, fordert aus Berlin einen unabhängigen Kriminalbeamten an. Kommissar Bonte wird nach Magdeburg geschickt, aber Konrad lehnt dessen Mitarbeit am Fall Blum grundsätzlich ab.
Bonte führt die Ermittlungen auf eigene Faust weiter, findet die Leiche Platzers in Gablers Keller und überführt Gabler schließlich des Mordes. Hecht versucht sich von dem „Irrtum“ Konrads zu distanzieren. Blum wird freigelassen und kann nach hause zurückkehren.

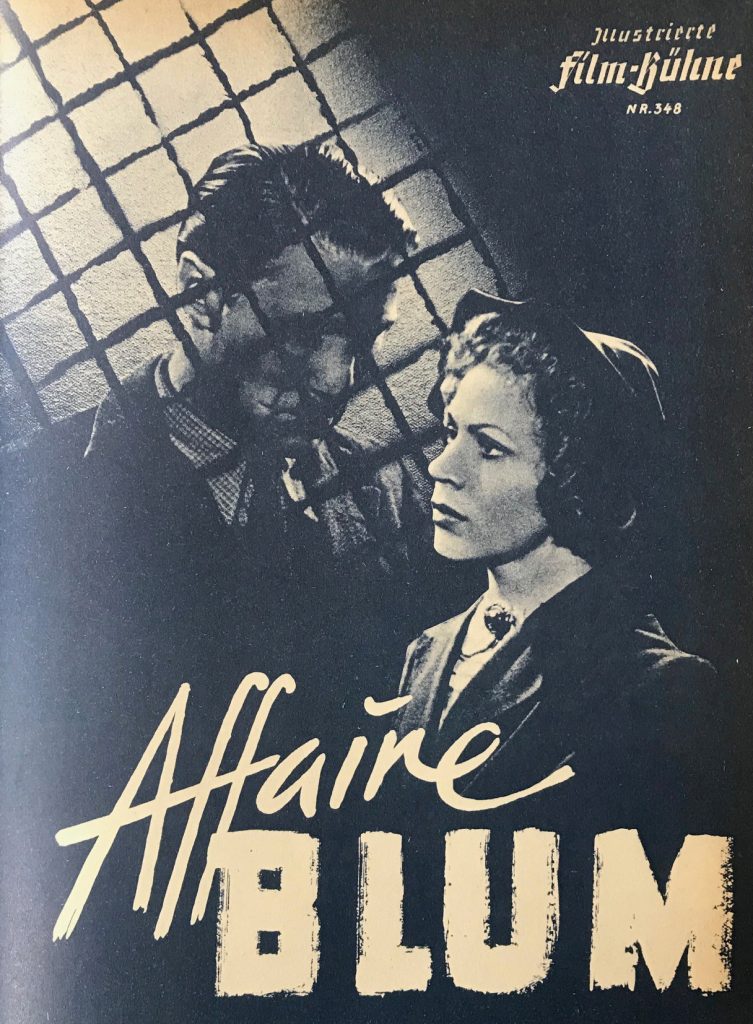
 Dieser Film beruht auf Tatsachen. Die Affaire liegt mehr als 20 Jahre zurück. Das Aufsehen, das sie damals erregte, ging über Deutschlands Grenzen hinaus. Aber in den folgenden Jahren wurde der Justizskandal totgeschwiegen, und nach dem Jahre 1933 wurden Prozeßakten und Dokumente vernichtet um diesen schandfleck der Justiz zu verwischen.
Dieser Film beruht auf Tatsachen. Die Affaire liegt mehr als 20 Jahre zurück. Das Aufsehen, das sie damals erregte, ging über Deutschlands Grenzen hinaus. Aber in den folgenden Jahren wurde der Justizskandal totgeschwiegen, und nach dem Jahre 1933 wurden Prozeßakten und Dokumente vernichtet um diesen schandfleck der Justiz zu verwischen.