Rosen für den Staatsanwalt (1959)
von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert
Annotation
Wolfgang Staudtes Justizsatire entlarvt die Kontinuitäten nationalsozialistischer Karrieren in der jungen BRD. Ein Kriegsrichter wird zum Staatsanwalt – und droht erneut, wegen Schokolade die Todesstrafe zu fordern. Bitter, pointiert, zeitkritisch.
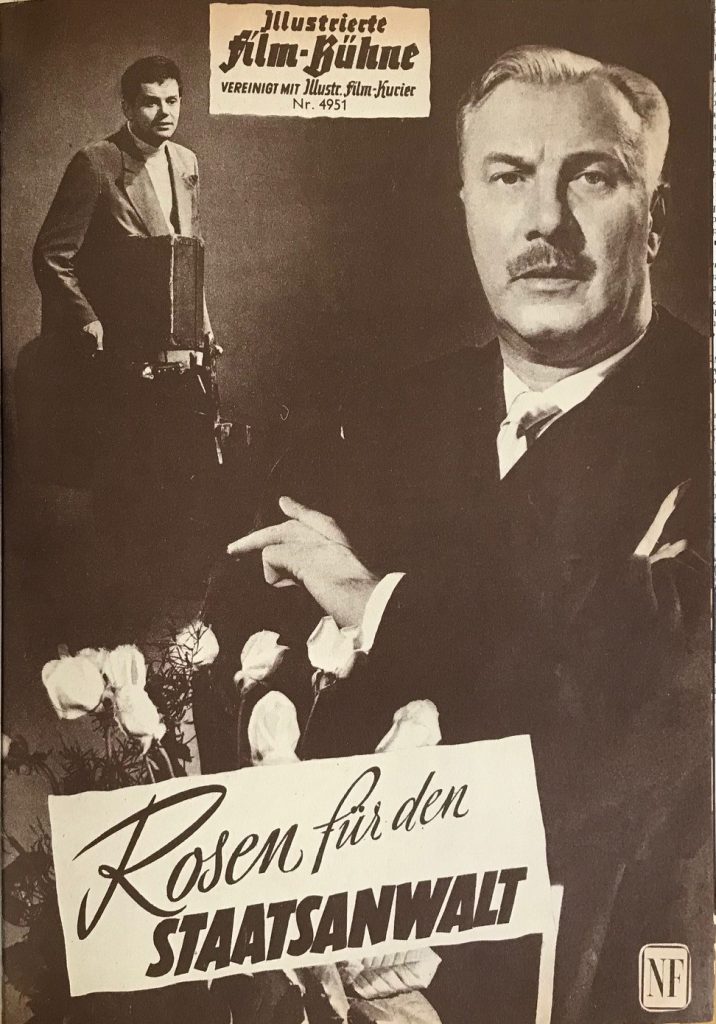
Regie : Wolfgang Staudte
Drehbuch : Georg Hurdalek
Produktion : Kurt Ulrich Filmproduktion
Produzent/-in : Kurt Ulrich
Kamera : Erich Claunigk
Schnitt : Klaus Eckstein
Musik : Raimund Rosenberger
Darsteller/innen:
- Walter Giller (Rudi Kleinschmidt)
- Martin Held (Dr. Wilhelm Schramm)
- Ingrid van Bergen (Lissy Flemming)
- Camilla Spira (Hildegard Schramm)
- Werner Peters (Otto Kugler)
- Paul Hartmann (Diefenbach)
- Wolfgang Preiss (Generalstaatsanwalt)
- Inge Meysel (Erna, Hausmädchen bei Schramms)
- Werner Finck (Haase)
- Ralf Wolter (Hessel)
- Roland Kaiser (Werner Schramm)
- Henry Lorenzen (Graumann, Kellner bei Lissy)
- Wolfgang Neuss (Paul, Lastwagenfahrer)
- Wolfgang Müller (Karl, Lastwagenfahrer)
- Burghard Ortgies (Manfred)
Land : Deutschland 1959
Länge: 97 Min. FSK: ab 12, ffr. FEW: w
Auszeichnungen: Deutscher Filmpreis 1960 (Filmband in Silber für den Film, für Walter Giller Georg Hurdalek
Im Jahr 1945 wird der junge Soldat Rudi Kleinschmidt wegen des Diebstahls von zwei Tafeln Schokolade von einem Kriegsgericht unter Leitung von Dr. Wilhelm Schramm zum Tode verurteilt. Das Urteil wird mit dem „nationalen Interesse“ begründet, doch Kleinschmidt entgeht durch Zufall der Hinrichtung. Jahre später ist Schramm ein angesehener Oberstaatsanwalt in der Bundesrepublik und verhilft einem wegen antisemitischer Äußerungen angeklagten Nationalsozialisten zur Flucht – ein Rosenstrauß dient als geheimes Zeichen für die geglückte Aktion. Kleinschmidt taucht zufällig in der Stadt auf, ohne Rachegedanken, doch Schramm sieht in ihm eine Bedrohung und versucht, ihn loszuwerden. Als Kleinschmidt aus Wut eine Fensterscheibe einschlägt, wird er erneut angeklagt – wieder sind zwei Tafeln Schokolade das belastende Beweisstück. Schramm übernimmt den Vorsitz in der Verhandlung und verfällt zusehends in seine alte Rolle als Kriegsrichter. Er fordert erneut die Todesstrafe, diesmal im demokratischen Rechtsstaat. Die groteske Wiederholung des damaligen Falls führt zu einem Disziplinarverfahren gegen ihn, und schließlich muss Schramm zurücktreten
Gedanken zum Film – vielleicht auch eine Anaylyse
Es gibt Filme, die eine Epoche beschreiben, und es gibt Filme, die eine Haltung entlarven. Rosen für den Staatsanwalt gehört zur zweiten Sorte. Er erzählt keine exotische Geschichte, sondern eine schmerzlich banale: die Fortsetzung der Macht mit anderen Mitteln, das Schweigen, das nicht heilt, und ein Recht, das in die falschen Hände gerät, weil zu viele so taten, als sei nichts geschehen. Wenn man ihn heute sieht, spürt man hinter den Pointen einen Zorn, der nicht verraucht ist: Wie konnte aus einem Kriegsrichter ein angesehener Oberstaatsanwalt werden? Wie konnte eine Gesellschaft so schnell zurückspringen in das bequeme Selbstbild des Anständigen? Und was macht das mit jemandem, der dem Tod durch Zufall entkam und später auf die höflich renovierte Fassade seines einstigen Peinigers trifft? Die Antwort des Films ist nicht juristisch, sie ist moralisch: Sie tastet den Puls einer Nachkriegsgesellschaft, die ihre Normalität so dringlich wollte, dass sie das Pathologische ihrer Vergangenheit in den Alltag hinüberpackte wie alte Möbel, die man zu schade zum Wegwerfen findet.
Der Ausgangspunkt ist einfach, fast lächerlich: ein Todesurteil wegen zweier Tafeln Schokolade, gesprochen in den letzten Kriegstagen von einem Mann, der das mit der Nation begründet. Der Soldat, Rudi Kleinschmidt, überlebt nur durch Zufall, taucht nach dem Krieg wieder auf, während der damalige Richter, Dr. Wilhelm Schramm, längst als Oberstaatsanwalt etabliert ist. Es ist eine Koinzidenz, die der Film nicht verbirgt, sondern ausstellt – ein Spiegel, in dem die 1950er-Jahre sich selbst betrachten sollen. Als Schramm später erneut auf Kleinschmidt trifft und dessen spontane Wut im Zerbrechen einer Scheibe endet, landen ausgerechnet wieder zwei Tafeln Schokolade als corpus delicti im Gerichtssaal. Schramm kippt zurück in seine Kriegsrichterpose, fordert de facto die Todesstrafe erneut – und entlarvt damit weniger den Angeklagten als sich selbst. In der Folge leitet man ein Disziplinarverfahren ein; der Mann, der einmal im Namen der Nation tötete, scheitert an seiner eigenen Vergangenheit, die sich im Falschen wiederholt.
Dass Wolfgang Staudte diese Geschichte 1959 gedreht hat, ist kein Zufall. Staudte war nie ein Regisseur der bequemen Bilder. Er wusste, wie freundlich Lachen klingen kann, wenn es etwas zudeckt, und wie scharf es wird, wenn es etwas aufschneidet. Seine Kamera bricht nicht mit dem ordentlichen Ton der Wirtschaftswunderjahre – sie benutzt ihn. Sie gleitet durch Amtsstuben und Wohnzimmer, in denen die Möbel poliert sind, aber die Sätze stumpf. Man sieht keine Exzesse, man sieht Gewohnheiten. Und gerade das macht wütend: Es handelt sich nicht um Monster, es handelt sich um Männer mit Bindestrichberufen, die in ihren Zwischentönen verraten, wie wenig der Krieg wirklich vorbei ist. Der Film schaut in ihre Lippenbekenntnisse hinein und zeigt, wie leicht aus Prinzipien wieder Parolen werden, wenn niemand aufpasst.
Schramm: Er ist kein unbeholfener Täter, kein naiver Mitläufer. Er ist die Kompetenz schlechthin – das macht ihn gefährlich. In seinen besten Szenen liegt die Brutalität nicht im Lauten, sondern im Abwägen. Der Mann, der in Uniform den Tod wie eine Fußnote begründete, trägt jetzt Anzüge, die tadellos sitzen. Die Fallhöhe liegt nicht im Wechsel des
Gerichtsdrama mit Déjà-vu
Raum-Zeit-Kontinuum
Justizsatire zwischen Kriegsende und Adenauer-Ära
Der Film operiert mit einer doppelten Zeitstruktur: Die Rückblende ins Jahr 1945 zeigt die willkürliche Todesverurteilung eines Soldaten wegen eines Bagatelldelikts – zwei Tafeln Schokolade –, während die Haupthandlung in der Bundesrepublik der späten 1950er Jahre angesiedelt ist. Diese zeitliche Verschränkung ist kein bloßes dramaturgisches Mittel, sondern verweist auf die Persistenz autoritärer Denk- und Handlungsmuster. Der Raum – Gerichtssaal, Stadt, Wohnung – wird zur Projektionsfläche gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Die Wiederholung des Delikts im neuen Kontext entlarvt die Kontinuität der juristischen Praxis.
Bezugs- und Bedingungsrealität
NS-Kontinuitäten im Gewand der Demokratie
Die Figur des Oberstaatsanwalts Schramm ist emblematisch für die juristische Elite, die ihre NS-Vergangenheit in die neue Ordnung hinüberrettet. Der Film nimmt Bezug auf reale gesellschaftliche Debatten über Schuld, Verantwortung und die mangelnde juristische Aufarbeitung der NS-Zeit. Die Produktionsbedingungen spiegeln die politische Kultur der Adenauer-Ära: Trotz Zensur und öffentlicher Zurückhaltung gelingt es Regisseur Wolfgang Staudte, eine kritische Botschaft in ein populäres Format zu kleiden. Die satirische Zuspitzung ist dabei nicht Selbstzweck, sondern Strategie zur Sichtbarmachung verdrängter Strukturen.
Filmrealität
Inszenierung als Mittel der Entlarvung
Die filmische Gestaltung arbeitet mit Kontrasten und Ironie. Die Kamera evoziert die beklemmende Atmosphäre des Gerichtssaals, während die Musik die groteske Überhöhung der Handlung unterstreicht. Martin Helds Darstellung des Schramm changiert zwischen bürokratischer Kälte und fanatischer Besessenheit. Die Montage verdichtet die narrative Wiederholung: Der Schokoladendiebstahl wird zur Chiffre für die Unfähigkeit, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Die filmische Realität dient hier der Entlarvung – nicht der Versöhnung.
Wirkungsrealität
Rezeptionsgeschichte als Spiegel gesellschaftlicher Aushandlung
Zeitgenössisch wurde der Film ambivalent aufgenommen. Während konservative Stimmen die satirische Zuspitzung kritisierten, lobten andere die mutige Thematisierung der NS-Kontinuitäten. Retrospektiv gilt Rosen für den Staatsanwalt als Schlüsselwerk der frühen BRD-Filmgeschichte. Die Rezeptionsgeschichte zeigt, wie Film als Medium der Erinnerungs-kultur wirken kann – nicht durch didaktische Belehrung, sondern durch narrative Irritation. Die Wirkung des Films liegt in seiner Fähigkeit, das Verdrängte sichtbar zu machen und zur Diskussion zu stellen.
Kostüms, sondern in der Kontinuität der Argumente. Es sind dieselben Worte, nur anders ausgeschmückt: Ordnung, Recht, Würde. Der Film nimmt diese Worte ernst – so ernst, dass sie unter dem Gewicht ihrer eigenen Geschichte knirschen. Der Zuschauer beobachtet, wie Schramm gegen ein Gespenst kämpft, das niemand sonst zu sehen scheint. Und sobald dieses Gespenst greifbar wird – zwei Schokoladentafeln vor Gericht – kippt die Rhetorik in die alte Pose. Es ist, als sei in ihm etwas konserviert worden, das auf ein Signal wartete, um sich wieder zu melden.
Der Gegenpart heißt Rudi Kleinschmidt. Er trägt keine Heldenpose, er hat keinen Masterplan der Vergeltung. Im Gegenteil: Seine Passivität entlarvt, wie einseitig Machtverhältnisse bleiben, wenn die Zeichen gewechselt haben. Er will nicht die Welt richten, er will in Ruhe gelassen werden, er will vielleicht sogar vergessen. Aber Vergessen ist kein Rechtstitel. Der Film macht daraus keine Anklage gegen das Opfer, sondern eine Anklage gegen eine Ordnung, die den Täter belohnt, weil er sich besser an die Formen des Nachkriegs hält. In Kleinschmidts Wutmoment – die Scheibe, die zu Bruch geht – steckt nicht die Lust an der Eskalation, sondern die Verzweiflung über die Kälte eines Systems, das gelernt hat, sich an ihm abzuarbeiten, statt an dem, der das System missbrauchte. Dass Kleinschmidt schlussendlich nicht zum Rächer wird, ist kein dramaturgischer Zufall. Es ist das moralische Zentrum des Films: Rache wäre zu bequem. Die Läuterung muss – wenn überhaupt – von innen kommen, aus dem Zusammenbruch einer Fassade, die sich selbst nicht mehr tragen kann.
Es gibt in diesem Film zwei Motive, die sich gegenseitig aufladen: die Schokolade und die Rosen. Die Schokolade ist der lächerliche Gegenstand, an dem das Beziehungsgeflecht sein Gift zeigt – der kleinste gemeinsame Nenner von Schuld und Opportunismus. Man lacht, weil es absurd ist, und das Lachen bleibt einem im Halse stecken: Wie kann so etwas Winziges zu einer Todesfrage werden? Die Rosen wiederum sind das geheime Zeichen für eine gelungene Flucht, die Schramm einem Belasteten ermöglicht hat – ein Bündel Schönheit als Code für das Gelingen der Vertuschung. In diesem Bild steckt die ganze Ambivalenz der Nachkriegszeit: Man dekoriert, man zeichnet aus, man händigt Blumen aus – und was man wirklich feiert, bleibt unausgesprochen. Die Rosen sind nicht nur ein Requisit; sie sind ein Kommentar zur Ästhetisierung der Unmoral. Der Film hält die Kamera lang genug darauf, damit man sieht, wie widersprüchlich Schönheit sein kann, wenn sie das Falsche begleitet.
Formell arbeitet der Film mit einem Doppelton: Komödiantische Leichtigkeit und juristisches Kammerspiel. Dieser Doppelton ist kein Widerspruch, er ist die einzige Möglichkeit, eine Gesellschaft zu treffen, die sich bereits an ihre Verdrängung gewöhnt hat. Humor wird hier nicht als Polster benutzt, sondern als Skalpell. Die Pointen geben dem Zuschauer Luft – und nehmen sie ihm gleich wieder. Schaut hin, wie die Dialoge funktionieren: Sie sind elegant und geschliffen und schlagen dann plötzlich nach innen. Man hört Sätze, die an die Oberfläche der Bürgerlichkeit passen, und man hört, wie sie ganz leicht schräg stehen, wie Möbel nach einem Umzug, die niemand richtig ausrichtet. Es ist ein Film der schiefen Bilder, der minimalen Abweichungen, und genau darin liegt seine Kraft: Er schreit nicht, er verschiebt.
Die Räume erzählen mit. Amtszimmer, Treppenhäuser, Straßenkreuzungen: Es sind keine spektakulären Schauplätze, sondern jene Orte, an denen Macht ihren Alltag hat. Ein Treppenhaus kann Schutz bieten oder Fallhöhe erzeugen; ein Büro kann Weite vorgaukeln und in Wirklichkeit Enge sein. Staudtes Blick ist architektonisch moralisch: „Wie du einen Raum betrittst, sagt, wie du in ihm handeln wirst.“ In den Gerichtssequenzen wirkt die Geometrie fast pädagogisch: Tische, Podeste, Blickachsen. Man sieht eine Ordnung, die Selbstbewusstsein ausstrahlen will – und je länger man hinsieht, desto mehr fällt auf, wie sehr diese Ordnung abhängig ist von denen, die sie vertreten. Wenn der Vertreter kippt, kippt der Raum. In dem Moment, in dem Schramm in die Pose des Kriegsrichters zurückfällt, verändern sich nicht nur Worte; der ganze Saal kippt spürbar aus der Balance. Es ist keine platte Metapher; es ist die Inszenierung der Fragilität einer Rechtsordnung, die die alten Gewohnheiten nie wirklich ausgetrieben hat.
Die Nebenfiguren sind keine Staffage, sondern Sensoren. In ihren kurzen Momenten zeigen sie, wo die Milde hockt und wo die Feigheit. Ein Kellner, der zu lange zuhört; ein Hausmädchen, das mehr versteht, als man ihm zutraut; ein Vorgesetzter, der Prinzipien zitiert und dabei in den Spiegel schaut. Was sie gemeinsam haben, ist ein Gespür für das, was alle wissen und keiner sagt. In ihren Halbsätzen steckt die stille Konspiration gegen das Erinnern. Das ist das Unheimliche: Die Unmoral organisiert sich nicht in abgedunkelten Hinterzimmern, sie geschieht in öffentlichen Höflichkeiten. Staudte lässt diese Figuren nie als Karikaturen stehen. Sie bleiben Menschen mit Gesten, die man kennt – und gerade deshalb möchte man sie schütteln. Denn ihre Nettigkeit ist die Schmiermittel-Variante der Komplizenschaft.
Wenn man sich die Tonspur vornimmt, hört man noch deutlicher, wie der Film arbeitet. Musik als ironisches Lächeln, das kurz vorm Erstarren ist; die Geräusche von Schuhen auf Stein, die an etwas erinnern, das man nicht mehr hören will; das Rascheln von Papier in Akten, das zu laut wirkt, weil die Sätze darin zu leise waren. Ton ist hier kein Ornament, er ist eine zweite Erzählstimme, die aus dem Off nicht erklärt, sondern aus dem Alltag heraus kommentiert. Das Geräusch der Rosen – ja, Rosen haben Geräusche, wenn man sie in dieser Form betrachtet – ist das Knistern des Unpassenden, das Festliche im Falschen.
Die dramaturgische Achse des Films ist nicht die Frage: Bekommt Kleinschmidt Gerechtigkeit? Sie lautet: Gibt es in dieser Ordnung eine Grenze, die sie selbst noch anerkennt? Deshalb ist das Disziplinarverfahren gegen Schramm so zentral. Nicht, weil es die passende Strafe wäre, sondern weil es überhaupt erst einmal markiert, dass die Kontinuität durchbrochen werden kann. Der Film behauptet nicht, dass dies genügt; er zeigt es als minimalen Riss, durch den Licht fällt. Alles andere wäre Illusion. Eine Gesellschaft, die so viel verschoben hat, kann sich nicht in einem Verfahren befreien. Aber sie kann beginnen, die Signale zu lesen: Wenn ein Mann, der Rosen als Zeichen für Mitschuld benutzt, in einem anderen Raum plötzlich keinen sicheren Stand mehr hat, dann stimmt etwas an den Achsen nicht – und das ist gut.
Es lohnt sich, auf die zeitliche Struktur zu achten: Der Sprung vom Kriegsgericht zum Nachkriegsgericht, die Jahre dazwischen als Leerraum, den der Film nicht mit Rückblenden füllt. Warum nicht? Weil dieser Leerraum gesellschaftlich bekannt ist, weil er in den Biografien der Zuschauer lebendig war, als der Film ins Kino kam. Staudte nimmt das Publikum ernst, vielleicht ernster, als es sich selbst nehmen wollte: Ihr wisst, was dazwischen passierte. Ihr kennt die Gespräche, die nicht stattgefunden haben. Ihr wisst, welche Ernennungen selbstverständlich wurden, welche Phrasen man wieder benutzte, als hätte nichts geschehen. Das Nicht-Gezeigte ist der große Mitspieler dieser Erzählung. Es drängt sich nicht in den Vordergrund – es sitzt im Saal, zwischen den Reihen.
Was macht der Film mit dem Gerechtigkeitsempfinden des Zuschauers? Er prüft seine Elastizität. Man möchte mit Kleinschmidt sein, aber er gibt einem nicht die klassischen Heldenmomente. Man möchte Schramm verurteilen, aber die Verurteilung kommt nicht als Gerichtsspruch mit finaler Geste. Was bleibt, ist die Unruhe, die nicht verschwindet. Das ist keine Schwäche, das ist der Punkt: Eine moralische Bildung, die nur in Endpunkten denkt, ist zu bequem. Der Film liefert keine Katharsis, er liefert ein unbequemes Gleichgewicht: Man weiß mehr als vorher, aber man kann sich schlechter beruhigen. Genau das war nötig, 1959 – und es ist heute noch selten.
In diesem Zusammenhang ist auch die Produktionsleistung erwähnenswert: Buch, Kamera, Schnitt – da stimmt die Disziplinierung der Mittel mit dem Thema überein. Dass Walter Giller als Rudi Kleinschmidt und Martin Held als Dr. Wilhelm Schramm die Achsen dieser Welt bilden, prägt die Präzision der Figurenzeichnung. Die Aneinanderfügung aus Eleganz und Härte in Helds Spiel, die spannungsgeladene Zurückhaltung bei Giller – diese Kombination ist das energetische Feld, in dem sich die Nebenrollen reiben. Der Film entstand 1959 in der Bundesrepublik, läuft 97 Minuten, und wurde in der Folge mit dem Filmband in Silber ausgezeichnet; auch die Leistungen von Giller und Drehbuchautor Georg Hurdalek wurden gewürdigt. Solche Auszeichnungen sind nicht bloß Meriten, sie sind Symptome: Eine Öffentlichkeit, die lacht und gleichzeitig etwas versteht, ist bereit, sich an einen Knoten zu setzen, der nicht gleich aufgehen wird.
Das juristische Motiv ist doppelt gebrochen: Einerseits wird Recht als Theater gezeigt – der Saal, das Ritual, die Sprache. Andererseits schiebt Staudte immer wieder Realität hinein, die sich nicht formalisieren lässt. Ein zerbrochenes Fenster ist nicht nur Sachbeschädigung, es ist ein Schrei. Zwei Schokoladentafeln sind nicht nur Eigentum, sie sind der Rückfall in eine Welt, in der Besitz das einzige Maß war. Und Rosen sind nicht nur Blumen, sie sind ein Signal. Die Kunst dieser Erzählung liegt darin, dass sie die Zeichen nicht erklärt, sondern aneinander reibt, bis sie Funken schlagen. Man merkt, wie das Denken zwischen Zeichen und Dingen pendelt – und genau in diesem Oszillieren entsteht der Erkenntnismoment: Recht ohne Erinnerung ist Form ohne Inhalt.
Natürlich ist es möglich, diesen Film als Satire zu lesen – und er funktioniert als Satire hervorragend. Aber wenn man ihn nur so liest, verpasst man seine Tiefe. Satire setzt voraus, dass die Dinge sich vom Lächerlichen her korrigieren lassen. Rosen für den Staatsanwalt ist skeptischer. Er benutzt das Lächerliche, um das Unkorrigierbare sichtbar zu machen: dass bestimmte Haltungen nicht verschwinden, wenn man die Namen austauscht. Er zeigt, wie Rationalität zur Tarnung werden kann. In den feinen Dialogverschiebungen, in den Blicken, die zu kurz ausgetauscht werden, liegt der Verdacht, dass ein Teil der Gesellschaft die Zeit nicht erlebt, sondern gemanagt hat. Das Lachen wird zur Disziplin – und was bleibt, ist das Bedürfnis, die Disziplin zu stören.
Es hilft, Staudtes Werk als Kontinuum zu sehen: Immer wieder beschäftigt ihn die Frage nach der Kontinuität von Schuld, nach den blinden Flecken der Macht. Hier jedoch richtet er den Fokus ganz auf die Ebenen der Justiz als moralischer Bühne der Bundesrepublik. Es ist eine delikate Zone: Dort, wo die Sprache so präzise wie möglich sein sollte, genügt ein millimetergroßer Zynismus, um alles zu verderben. Staudte zeigt, wie sich dieser Zynismus einnistet: nicht als großes Laster, sondern als kleine Gewohnheit. Ein Schulterzucken, ein „So sind die Regeln“, ein „Es ist nicht so gemeint“. Die Nachkriegsgesellschaft versteckt sich in diesen Halbsätzen, und der Film nimmt sie ernst, weil er weiß, dass nur die Halbsätze eine Gesellschaft wirklich verraten.
Ab einem gewissen Punkt stellt man sich vielleicht die Frage: Wo liegt in diesem Film Hoffnung? Nicht als Happy End, das wäre unpassend. Hoffnung liegt im Störgeräusch. Im Moment, in dem Schramm die Kontrolle verliert, fängt etwas an, das jenseits dieser Figur Bedeutung hat. Es ist die Einsicht, dass Kontrolle eine moralische Kategorie ist, kein rein administratives Können. Man kann ein System nicht retten, indem man es besser spielt, wenn das innere Fundament falsch ist. Der Einbruch im Gerichtssaal ist das öffentliche Sichtbarwerden eines privaten Defekts – und darin liegt die Chance: Sichtbarkeit zwingt zur Sprache, Sprache zwingt zur Stellungnahme. Die Gesellschaft, die sich an Ordnung gewöhnt hatte, muss etwas anderes lernen: die Fähigkeit, über Ordnung zu sprechen, wenn sie nicht mehr trägt.
Wenn man auf die Frauenfiguren achtet, erkennst man eine weitere Schicht: Sie sind oft diejenigen, die kein Amt, aber ein Gedächtnis haben. Ihr Blick ist weniger von der Rhetorik gefesselt und eher am konkreten Verhalten orientiert. In ihren Reaktionen liegt eine Form von Urteil, die nicht in Paragrafen geschrieben ist: Wer ist hier eigentlich anständig? Wer hat gelernt zu sehen? Das sind kleine Momente, oft in Nebenbewegungen, die der Film nicht groß ausspielt – und gerade darin sind sie stark. Sie zeigen eine Moral, die nicht nachträglich begründet wird, sondern im Alltag atmet. In einer Welt, in der die Männer die Orden tragen, tragen die Frauen die Erinnerung.
Die Frage nach der Schuld ist hier kein metaphysischer Kloß, sondern eine Praxis. Was tust du, wenn du die Macht hast, einen anderen zu unterdrücken? Was tust du, wenn du die Macht hast, ihn laufen zu lassen? Und was tust du, wenn du die Macht hast, dich selbst zu entlasten? Diese Fragen sind nicht abstrakt. Sie sind der Stoff, aus dem Karrieren gemacht werden – und zerstört. Die Entscheidung, einem wegen antisemitischer Äußerungen Angeklagten zur Flucht zu verhelfen, ist im Film nicht nur eine biografische Episode. Sie markiert einen Punkt, an dem öffentliche Moral privat disponiert wird. Ein Strauß Rosen legt sich auf das Gewissen – aber er deckt es nicht zu, er färbt es ein. Von hier aus ist der Weg zur Eskalation im Gerichtssaal nicht mehr weit: Wer einmal die Grenze in sich verschoben hat, wird sie dort, wo alle zuschauen, wieder suchen.
Man könnte den Film auch als Lehrstück über Zeichen und Macht lesen: Wer definiert, was ein Zeichen bedeutet? In der Kriegszeit sind zwei Schokoladentafeln ein Symbol der Disziplinlosigkeit, die mit dem Tod zu bestrafen ist. Nach dem Krieg sind sie nur noch eine Ware – und werden im Saal doch wieder zu einem Symbol, weil Schramm sie dazu macht. Zeichen sind also nicht neutral; sie erhalten ihr Gewicht aus dem, der sie benutzt. Das aber heißt: Die Veränderung des Kontextes genügt nicht, wenn die Deutungsmacht bei denselben bleibt. Der Film insistiert darauf, dass Gerechtigkeit nicht nur korrekt angewandte Paragrafen braucht, sondern eine moralische Sprache, die sich nicht von alten Sprechern entführen lässt.
Wenn man die Inszenierung unter dem Aspekt des Tempos betrachtet, fällt die Ruhe auf, mit der Staudte Eskalationen vorbereitet. Es gibt wenige schnelle Schnitte, wenig Hektik; dafür eine rhythmische Geduld. Die Geduld ist nicht gemütlich. Sie ist die Zeit, die ein System braucht, um sich zu zeigen. Man bekommt Gelegenheit, sich an die Oberfläche zu gewöhnen – und genau dann verschiebt er sie einen Millimeter. Diese Methode ist riskant: Wer nur auf den Plot wartet, könnte ungeduldig werden. Aber sie ist ehrlich gegenüber dem Gegenstand. Es geht nicht um eine Aufdeckung im Krimi-Sinn; es geht um die Wahrnehmung eines Klimas. Ein Klima enthüllt sich nicht in einem Twist; es legt sich über einen, und irgendwann merkt man, dass die eigene Atmung anders geworden ist.
Darin liegt auch ein didaktischer Wert, der selten so klar erreicht wird: Der Film eignet sich nicht, um Informationen über die 1950er-Jahre zu vermitteln; er eignet sich, um das Gefühl zu vermitteln, wie sich diese Jahre für jene anfühlten, die mehr wussten als sie sagten. In Unterrichtszusammenhängen ist das Gold wert – nicht als moralisches Schaubild, sondern als Trainingsraum für Ambiguitätstoleranz. Wer diesen Film ernsthaft bespricht, kommt um die eigenen Reflexe nicht herum: Wie schnell fordere ich klare Urteile? Wie ungeduldig werde ich, wenn das Lachen nicht entlastet, sondern belastet? Wie gehe ich mit Figuren um, die nicht den Komfort liefern, den ich erwarte?
Es gibt eine Gefahr bei Filmen dieser Art: dass man sie als Dokumente ihrer Zeit abheftet. Rosen für den Staatsanwalt lässt sich dagegen wehren. Zu vieles an ihm wirkt wie eine Antwort auf die Gegenwart: die Frage, wie Systeme sich durch Personen fortpflanzen; wie schnell Prinzipien zu Floskeln werden; wie leicht Humor zur Waffe wird, wenn er nicht doppelt gerichtet ist. Die Pointe dieser Übertragbarkeit ist nicht, dass „alles gleich bleibt“. Die Pointe ist, dass wir einen Sinn für Kontinuitäten entwickeln müssen, der nicht fatalistisch ist. Der Film beweist, dass Kontinuitäten sichtbar gemacht werden können – und dass diese Sichtbarkeit eine Voraussetzung für Veränderung ist.
Spannend ist auch, wie der Film das Verhältnis von Zufall und Struktur zeichnet. Der Zufall rettet Kleinschmidt vor dem Erschießungskommando; der Zufall führt ihn wieder in die Stadt; der Zufall bringt die Schokolade in den Saal. Aber diese Zufälle arbeiten gegen eine Struktur, die sie erst bedeutend macht. Der Zufall ist der Katalysator; die Struktur ist die eigentliche Reaktionsmasse. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil sie uns daran erinnert, den Blick nicht am Ereignis festzukleben, sondern an den Bedingungen. Nicht: „Wie wahrscheinlich ist es, dass just diese Schokolade wieder auftaucht?“ Sondern: „Wie kann es sein, dass dieses Auftauchen etwas Derartiges auslöst?“ Darin liegt die Diagnose des Films.
Zuletzt: Es ist nicht unwichtig, dass der Film Erfolg und Anerkennung fand. Nicht, weil Preise Wahrheiten verbürgen, sondern weil sie zeigen, dass ein Publikum – langsam, sehr langsam und mit Rückfällen – bereit war, sich an dieser Mischung aus Witz und Wunde abzuarbeiten. 1960 erhielt der Film das Filmband in Silber; gewürdigt wurden auch die Leistungen von Walter Giller und Georg Hurdalek. Hinter solcher Anerkennung steht eine kollektive Übung: die Bereitschaft, sich vertreten zu lassen von einer Kunst, die kein bequemes Bild liefert, sondern ein unrundes. Man könnte sagen: Die Rosen des Films sind, im besten Sinne, zurückgekommen – nicht als Zeichen für eine gelungene Flucht, sondern als Zeichen dafür, dass etwas begonnen hat: das Sprechen über das, was man nicht mehr verschönern kann.
Wenn man mit dem Abspann sitzen bleibt, bleibt der Blick an zwei Stellen hängen: an den Händen – wer hält was, wem wird was gereicht – und an den Stimmen. In den Händen liegt die Handlungsmacht, in den Stimmen die Ermöglichung. Rosen für den Staatsanwalt führt beide zusammen und fragt: Was tust du, wenn dir eine alte Stimme ein altes Zeichen in die Hand drückt – und es heute wieder wie früher funktionieren soll? Der Film gibt keine Antworten im Imperativ. Er zeigt, wie Antworten scheitern, wenn sie nicht vorher die Frage ernst genommen haben. Deshalb wirkt er nach: als leise Unruhe im eigenen Urteil, als Misstrauen gegen zu glatte Erzählungen, als Bereitschaft, in einem Lachen zu prüfen, ob es wirklich Befreiung bedeutet oder nur ein neues Band.
Vielleicht ist das die nachhaltigste Leistung dieses Films: Er zwingt dazu, den Begriff der Anständigkeit neu zu definieren. Nicht als soziale Konvention, nicht als juridische Korrektheit, sondern als Fähigkeit, Geschichte im eigenen Sprechen zu hören. Wer das lernt, wird beim nächsten Mal die Schokolade nicht als Entwertung des Ernstes lesen, sondern als sein Brennglas. Und wer das gelernt hat, wird die Rosen nicht mehr als hübsches Ritual betrachten, sondern als Prüfstelle: Was wird hier eigentlich gefeiert? Wenn man diese Prüfung anlegt, beginnt der Film, außerhalb seiner Laufzeit zu arbeiten – in deinen Gesprächen, in deinen Urteilen, vielleicht sogar in deinen Gewohnheiten. Und genau dorthin wollte er.
Ein Vergleich der beiden Gerichtsszenen in Rosen für den Staatsanwalt (1959) offenbart die zentrale dramaturgische und ideologische Struktur des Films. Beide Szenen sind nicht nur narrative Eckpfeiler, sondern fungieren als Spiegel für die historische Kontinuität juristischer Macht und die Unfähigkeit zur Selbstreflexion im Nachkriegsdeutschland.
Gerichtsszene 1945:
Todesurteil als Ausdruck autoritärer Willkür
Die erste Szene zeigt ein Kriegsgericht unter Leitung von Dr. Wilhelm Schramm. Der junge Soldat Rudi Kleinschmidt wird wegen des Diebstahls von zwei Tafeln Schokolade zum Tode verurteilt. Die Begründung erfolgt mit pathetischem Verweis auf das „nationale Interesse“. Die Szene ist inszeniert als kafkaeske Farce: Der Delikt ist banal, die Reaktion grotesk übersteigert. Die Kamera betont die Kälte des Raums, die Uniformen unterstreichen die militärische Disziplin, und Schramms Tonfall ist von ideologischer Härte geprägt. Die Szene steht exemplarisch für die juristische Praxis im NS-Staat, in der Recht zum Instrument der Macht wurde.
Gerichtsszene 1950er Jahre:
Wiederholung als Entlarvung
Die zweite Szene spielt in der Bundesrepublik, erneut unter Vorsitz von Schramm. Wieder steht Kleinschmidt vor Gericht, wieder geht es um zwei Tafeln Schokolade – diesmal als Folge einer impulsiven Handlung, nachdem er eine Scheibe eingeworfen hat. Die Koinzidenz des Delikts lässt Schramm die Kontrolle verlieren. Er verfällt zusehends in seine Rolle als Kriegsrichter und fordert erneut die Todesstrafe. Die Szene ist inszeniert als Reinszenierung: Die Kulisse ist bürgerlich, doch die Rhetorik und Gestik Schramms sind identisch mit der Vergangenheit. Die Wiederholung entlarvt die Kontinuität autoritärer Denkweisen. Die Kamera fokussiert Schramms Gesicht, das zunehmend fanatisch wirkt, während die Umgebung in bürgerlicher Normalität verharrt.
Vergleich: Struktur, Funktion und Wirkung
| Aspekt | Gerichtsszene 1945 | Gerichtsszene 1950er Jahre |
| Delikt | Diebstahl von Schokolade im Krieg | Diebstahl von Schokolade nach Fenstereinwurf |
| Richter | Dr. Schramm als Kriegsrichter | Dr. Schramm als Oberstaatsanwalt |
| Inszenierung | Militärisch, kalt, pathetisch | Bürgerlich, grotesk, eskalierend |
| Reaktion Schramms | Ideologisch motiviertes Todesurteil | Rückfall in NS-Rhetorik, Forderung der Todesstrafe |
| Funktion im Film | Einführung der zentralen Konfliktfigur | Höhepunkt der Entlarvung und Eskalation |
| Wirkung auf Publikum | Schock über Willkür im NS-System | Erkenntnis der Kontinuität und Verdrängung |
Die Wiederholung des Delikts und der juristischen Reaktion ist kein Zufall, sondern dramaturgisches Mittel zur Entlarvung. Die beiden Szenen bilden ein dialektisches Paar: Vergangenheit und Gegenwart verschränken sich, die Maske der Demokratie fällt, und die autoritäre Struktur tritt erneut hervor. Der Film nutzt diese Parallelität, um die These zu stützen, dass die BRD der 1950er Jahre in Teilen eine restaurative Gesellschaft war – unfähig, sich ihrer Vergangenheit zu stellen.
Zeitpunkt im Film: ca. Minute 2:00–6:30
| Zeit | Einstellung | Bildinhalt / Kameraperspektive | Funktion / Wirkung |
| 02:00 | Totale | Gerichtssaal, Offiziere in Uniform | Etablierung des autoritären Raums |
| 02:30 | Halbtotale | Schramm am Richtertisch, frontal | Einführung der zentralen Machtfigur |
| 03:00 | Nahaufnahme | Schramms Gesicht, starre Miene | Betonung ideologischer Härte |
| 03:30 | Halbnah | Kleinschmidt vor dem Tribunal | Opferperspektive, visuelle Unterwerfung |
| 04:00 | Detail | Schokoladentafeln als Beweisstück | Symbolisierung der absurden Strafpraxis |
| 04:30 | Schwenk | Von Schramm zu den Beisitzern | Darstellung kollektiver Zustimmung |
| 05:30 | Nahaufnahme | Schramm beim Urteilsspruch | Höhepunkt der Willkür |
| 06:15 | Totale | Gerichtssaal nach dem Urteil | Atmosphäre der Unabwendbarkeit |
Zeitpunkt im Film: ca. Minute 80:00–85:30
| Zeit | Einstellung | Bildinhalt / Kameraperspektive | Funktion / Wirkung |
| 80:00 | Halbtotale | Gerichtssaal, bürgerlich eingerichtet | Kontrast zur NS-Ästhetik |
| 80:30 | Halbnah | Kleinschmidt als Angeklagter | Wiederholung der Opferrolle |
| 81:00 | Nahaufnahme | Schramm, zunehmend erregt | Eskalation, Kontrollverlust |
| 81:30 | Detail | Zwei Tafeln Schokolade | Ironische Wiederholung des Delikts |
| 82:00 | Kamerafahrt | Vom Publikum zum Richtertisch | Einbeziehung der Zuschauerperspektive |
| 83:00 | Nahaufnahme | Schramm beim Urteilsvorschlag | Höhepunkt der Eskalation |
| 84:00 | Halbnah | Reaktionen der Zuschauer | Kontrastierende Normalität |
| 85:15 | Totale | Gerichtssaal nach dem Eklat | Schramm isoliert, Entlarvung |
Satire, Komödie und Milieubilder erzeugten argumentative Reichweite
Detlef Endeward (2022)
Die Filme Wir Wunderkinder (1958, Regie: Kurt Hoffmann) und Rosen für den Staatsanwalt (1959, Regie: Wolfgang Staudte) markieren in der westdeutschen Nachkriegskinematographie zwei komplementäre Formen der Auseinandersetzung mit Kontinuitäten zwischen NS-Zeit und Bundesrepublik. Im Sinne einer historisch-kritischen Filmanalyse werden sie hier vergleichend betrachtet entlang der Dimensionen, die die Verflechtung von filmischer Gestaltung, historischer Referenz, Produktionsbedingungen und Rezeptionsweisen sichtbar machen. Das gemeinsame Thema, die Persistenz von Haltungen, Opportunitätsstrukturen und institutionellen Praktiken über den Epochenschnitt von 1945 hinaus, wird dabei in zwei unterschiedlichen dramaturgischen Formaten und jeweils eigener filmischer Rhetorik entfaltet: als epochenübergreifende, satirisch gebrochene Lebenslaufchronik in Wir Wunderkinder und als komödiantisch zugespitztes Justizdrama im Mikrokosmos einer westdeutschen Stadt in Rosen für den Staatsanwalt. Der Vergleich zeigt, wie unterschiedlich verteilte erzählerische Gewichte – Wirtschaft und soziale Eliten hier, Justiz und verwaltete Moral dort – auf dasselbe gesellschaftliche Problem zielen: die Normalisierung des Nicht-Aufgearbeiteten.
Vergangenheit: Die Handlung beginnt 1945 mit einem absurden Todesurteil gegen einen Soldaten wegen Schokoladendiebstahls – Symbol für die Willkür der NS-Militärjustiz.
Gegenwart im Film: Etwa Mitte/Ende der 1950er Jahre – der Täter von damals ist nun Oberstaatsanwalt, die Gesellschaft hat ihn rehabilitiert.
Raumgestaltung: Gerichtssäle, Amtsstuben, Wohnzimmer – Orte der Macht, Kontrolle und bürgerlichen Fassade.
Gesellschaftlicher Kontext: Adenauer-Ära, Wirtschaftswunder, Verdrängung der NS-Vergangenheit.
Filmische Botschaft: Der Film kritisiert die Kontinuität von NS-Mentalitäten in der Justiz und die fehlende Aufarbeitung.
Mutige Satire: Staudte nutzt Humor und Überzeichnung, um die Absurdität und Gefährlichkeit dieser Verdrängung sichtbar zu machen.
a) Zeitgenössische Rezeption (1959–60er Jahre)
Der Film wurde teils als „Nestbeschmutzung“ wahrgenommen.
Kritik an der Justiz war gesellschaftlich heikel – Staudte stieß auf Widerstand.
b) Spätere Rezeption (ab 1980er Jahre)
Neubewertung als wichtiger Beitrag zur Erinnerungskultur.
Der Film gilt heute als Vorläufer der kritischen Vergangenheitsbewältigung im deutschen Kino.
c) Didaktische Rezeption (heute, z. B. im Unterricht)
Film wird als Quelle für Mentalitätsgeschichte und NS-Kontinuitäten genutzt.
Ideal für die Analyse von Schuld, Verantwortung und gesellschaftlicher Verdrängung
|
Element |
Beispiel im Film |
Interpretation |
|
Symbolik |
Scho-Ka-Kola-Dose |
Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart |
|
Raum |
Amtsstube Schramms |
Ort der Macht, aber auch der moralischen Leere |
|
Dialoge |
„Wegen sowas erhebt man doch keine Anklage“ |
Relativierung von NS-Verbrechen |
|
Montage |
Wechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart |
Enthüllung von Kontinuitäten |
Rosen für den Staatsanwalt konstruiert ein Raum-Zeit-Kontinuum, das die NS-Zeit und die Adenauer-Ära nicht trennt, sondern verbindet. Der Film wird zur Quelle gesellschaftlicher Selbstreflexion: Er zeigt, wie tief NS-Mentalitäten in der Nachkriegsgesellschaft verankert waren – und wie Film als Medium diese Verdrängung sichtbar machen kann.
Film in der BRD der 50er und frühen 60er Jahre
Filmansicht bei Youtube möglich
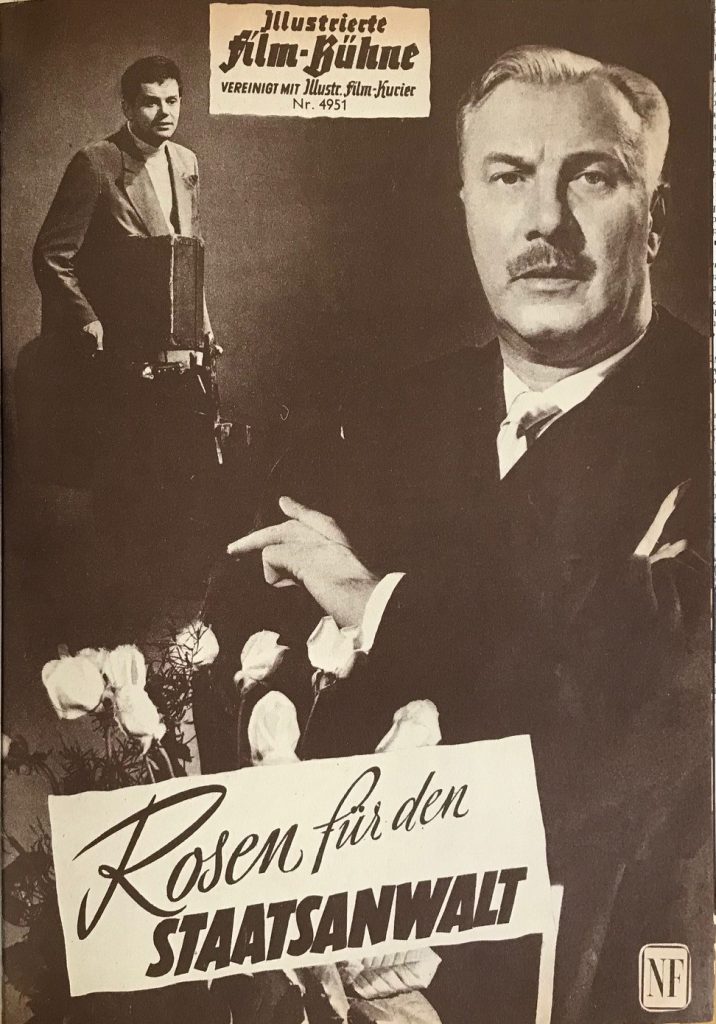
Regie : Wolfgang Staudte
Drehbuch : Georg Hurdalek
Produktion : Kurt Ulrich Filmproduktion
Produzent/-in : Kurt Ulrich
Kamera : Erich Claunigk
Schnitt : Klaus Eckstein
Musik : Raimund Rosenberger
Darsteller/innen:
- Walter Giller (Rudi Kleinschmidt)
- Martin Held (Dr. Wilhelm Schramm)
- Ingrid van Bergen (Lissy Flemming)
- Camilla Spira (Hildegard Schramm)
- Werner Peters (Otto Kugler)
- Paul Hartmann (Diefenbach)
- Wolfgang Preiss (Generalstaatsanwalt)
- Inge Meysel (Erna, Hausmädchen bei Schramms)
- Werner Finck (Haase)
- Ralf Wolter (Hessel)
- Roland Kaiser (Werner Schramm)
- Henry Lorenzen (Graumann, Kellner bei Lissy)
- Wolfgang Neuss (Paul, Lastwagenfahrer)
- Wolfgang Müller (Karl, Lastwagenfahrer)
- Burghard Ortgies (Manfred)
Land : Deutschland 1959
Länge: 97 Min. FSK: ab 12, ffr. FEW: w
Auszeichnungen: Deutscher Filmpreis 1960 (Filmband in Silber für den Film, für Walter Giller Georg Hurdalek
(…) Diese Anspielung auf die Flucht des Offenburger Studienrats und Judenfressers Ludwig Zind lieferte den Titel – »Rosen für den Staatsanwalt« – des zeitnahen Films, den der Berliner Spezialist für filmische Gesellschaftskritik, Wolfgang Staudte („Die Mörder sind unter uns«, »Der Untertan“), in der vergangenen Woche fertigstellte. Noch vor einem halben Jahr hatte freilich nicht einmal Staudte selbst geglaubt, daß der Film, den der NF -Verleih jetzt als »unheimlich aktuelles« Werk ankündigt, jemals über das Rohkonzept hinaus gedeihen würde. Der Regisseur bedachte den Entwurf damals mit dem Randvermerk: »Gedanken zu einem Film, der nie gedreht wird.« (…)
aus: Die Mörder sind über uns – Der Spiegel 36/1959 – 01.09.1959
»Wie redlich oder wie wirksam die Filme von Staudte als Propaganda auch sein mögen – als Kunst (das heißt als Beschreibung, was Menschen fühlen) sind sie zu simpel, schwerfällig und konstruiert. Im vorliegenden Fall können die kunstvolle Ausleuchtung und die wuchtige Regie die Schwächen der billigen Karrikatur und der verkrampften Launigkeit nicht verdecken; was einen wieder einmal daran erinnert, daß es der deutsche Film immer noch nicht geschafft hat, sich mit dem Thema der Schuld zu beschäftigen, ohne sich in groteske Über-Simplifizierungen zu verlieren« Raymond Durgnat, Films and Filming, zitiert bei: C. Bandmann/J. Hembus: Klassiker des deutschen Tonfilms 1930 – 1980, München 1980, S. 234
Wie in „Die Mörder sind unter uns“ greift Staudte hier das Thema der Kontinuität der Macht, die aus dem Dritten Reich in die Bundesrepublik Deutschland reicht, auf. Und auch dieser Film ist ein Plädoyer dafür, diese verhängnisvolle Kontinuität zu durchbrechen. Daß einflußreiche Juristen der Bundesrepublik ihre Tätigkeiten aus der Zeit des Nationalsozialismus fortsetzen und die Verbrechen des Regimes eher verschleiern denn aufdecken wies sich zur Zeit der Uraufführung des Films noch an zahlreichen authentischen Beispielen aus (so etwa im Fall des antisemitischen Studienrats Zind, der mit Hilfe eines sympathisierenden Angehörigen in der Justizbehörde fliehen konnte). Staudte hat das Porträt des faschistischen Richters jedoch mit einer Anzahl karikierender, unrealistischer Elemente versetzt, so daß sich bisweilen, auch durch das Spiel von Martin Held begünstigt, eher Mitleid mit dem Protagonisten einstellt. Auch die psychische Fehlleistung des Richters am Ende wirkt eher verharmlosend.
Zentrale Filmografie Politische Bildung. Hrsg. vom Institut Jugend Film Fernsehen, München, Band II: 1982, S 179
Rosen für den Staatsanwalt“ ist eine intelligente Zeitsatire, die Regisseur Wolfgang Staudte (1906-1984) mit dem Ziel realisierte, das politische Bewusstsein der Bundesbürger zu schärfen. Der hellsichtige Film hat auch heute nichts von seinem kabarettistischen und provokativen Witz eingebüßt. Ende der 50er Jahre wird Staudte durch den Fall des Offenburger Studienrates Zind, der wegen antisemitischer Äußerungen zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wird, zu „Rosen für den Staatsanwalt“ angeregt und entwirft nach dem authentischen Fall ein bitteres, aber äußerst realistisches Bild der frühen Bundesrepublik. Als „Nestbeschmutzer“ diffamiert, lehnt er die Auszeichnung mit dem Bundesfilmpreis 1960 ab.
(arte)
(…) Am Beispiel von „Rosen für den Staatsanwalt“ ließe sich trefflich diskutieren, welche Form der Inszenierung geeigneter ist, um gesellschaftskritische Inhalte zu transportieren. Ein Unterhaltungsfilm, der seine Kritik satirisch formuliert, dabei in Kauf nehmend, dass sie nicht wahrgenommen wird, oder ein ernsthafter, konkret den Finger in die Wunde legender Film, der nur ein zahlenmäßig kleines Publikum erreicht. Nachdem Wolfgang Staudte gemeinsam mit Harald Braun und Regisseur Helmut Käutner eine eigene Produktionsgesellschaft gegründet hatte, brachte er 1960 „Kirmes“ heraus, eine kompromisslose Abrechnung mit der Entwicklung Deutschlands nach dem Krieg. 1964 erschien mit „Herrenpartie“ sein letzter Film, der sich mit den Folgen des Nationalsozialismus auseinandersetzte, der ihm heftige Kritik und den Vorwurf der „Nestbeschmutzung“ einbrachte. Beide Filme wurden vom damaligen Publikum abgelehnt und sind heute nahezu unbekannt – nur „Rosen für den Staatsanwalt“ hat überlebt. (…)
Auszug aus: Udo Rotenberg: Rosen für den Staatsanwalt (1959) Wolfgang Staudte – 16.05.2013 [15.11.2022]
Rosen für den Staatsanwalt (1959) kommt eine besondere Bedeutung zu, weil der Filmmit Bravour den Spagat zwischen Anspruch und Unterhaltung schafft: Einerseitsthematisiert Staudte die NS-Aufarbeitung auf ein Neues, wenn auch diesmal mit einemthematisch etwas anderen Einschlag. Andererseits bereitet er sein Thema in so populärerWeise auf, dass der Streifen zum Kassenschlager wird und noch heute, jenseits seinerrein politischen Botschaft, zu den absoluten Klassikern des Fünfziger-Jahre-Kinos zählt. > weiter
aus: Lutz Frühbrodt: Wolfgang Staudte – der angebliche Nestbeschmutzer /Teil 2. 14. August 2021, S. 1-3




