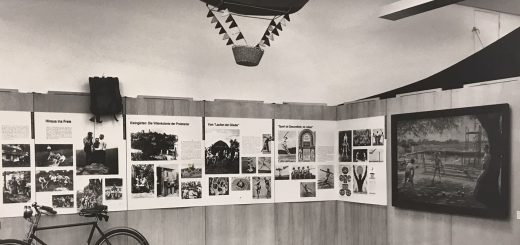Der Bergfilm
 Arnold Fanck am Sellapass, vermutlich bei Dreharbeiten zum Film Der heilige Berg im Oktober 1925 (gemeinfrei)
Arnold Fanck am Sellapass, vermutlich bei Dreharbeiten zum Film Der heilige Berg im Oktober 1925 (gemeinfrei)
Zwischen Naturmythos, Technik und Ideologie
Detlef Endeward (05/2025)
Der Bergfilm der 1920er- und frühen 30er-Jahre war weit mehr als Abenteuerkino vor spektakulärer Naturkulisse. Der sogenannte Bergfilm entwickelte sich in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre zu einem eigenständigen Genre des deutschen Kinos. Inmitten der kulturellen Dynamik der Weimarer Republik verband er spektakuläre Naturaufnahmen mit dramatischen Handlungen, die häufig heroische Selbstüberwindung, Opferbereitschaft und Naturverbundenheit thematisierten. Die Filme entstanden unter extremen Bedingungen an Originalschauplätzen in den Alpen und zeichneten sich durch eine bis dahin im deutschen Kino unbekannte Authentizität aus.
Die Ursprünge des Genres liegen in den dokumentarischen Arbeiten von Arnold Fanck, der mit seiner Berg- und Sportfilm GmbH ab 1920 Spielfilme wie Der Berg des Schicksals (1924) oder Der heilige Berg (1926) produzierte. Mit Schauspieler Luis Trenker und der Tänzerin Leni Riefenstahl entstanden Werke, die das Hochgebirge als Bühne für existenzielle Konflikte inszenierten.
Charakteristika des Bergfilms der Weimarer Republik
Das Genre war gekennzeichnet durch klare ästhetische, technische und ideologische Merkmaln:
Authentizität und Originalschauplätze
- Drehorte waren reale Hochgebirgsschauplätze, keine Studioimitationen.
- Die physischen Herausforderungen bei Dreharbeiten spiegelten sich in den Heldenfiguren wider (vgl. Rapp, Höhenrausch, 1997).
Thematische Leitmotive
- Selbstüberwindung und körperliche Leistung als Weg zur Erhöhung.
- Natur nicht als Kulisse, sondern als spiritueller Prüfstein oder „Gegenspieler“ des Menschen.
- Heldentum, Opfer, Reinheit – meist männlich konnotiert – dominieren die Erzählungen.
Filmästhetik
- Weitwinkelaufnahmen und dynamische Kamerabewegungen verstärken das Gefühl von Raum und Gefahr.
- Kontrast zwischen menschlicher Kleinheit und übermächtiger Natur.
- Dramaturgie betont Steigerung, Krise, moralische Läuterung.
Deutungen
Doch der Bergfilm war mehr als nur Abenteuerkino: Er transportierte ein spezifisches Weltbild. Wie Siegfried Kracauer in Von Caligari zu Hitler (1979) analysierte, spiegelte der Kult um das Gebirge eine autoritäre Mentalität wider, die sich durch Antirationalismus, Elitenkult und Naturmystik auszeichnete. Kracauer sah in der „Vergötzung von Gletschern und Felsen“ eine Vorform jener Ideologie, die später vom Nationalsozialismus vereinnahmt wurde.
Auch Christian Rapp betont in seiner Monografie Höhenrausch (1997), dass der Bergfilm nur in einem soziokulturellen Umfeld gedeihen konnte, das auf „feierliches Pathos“ und „Schicksalsgläubigkeit“ konditioniert war. Die Authentizität der Drehorte und die körperliche Leistung der Darsteller wurden zum Teil des filmischen Mythos.
Historischer Ausstattungsfilm
Science-Fiction und Technikutopien
Filmlustspiel
Gesellschaftskritischer Film
Avantgarde und Kulturfilme