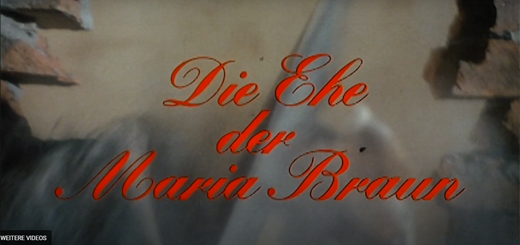Anklagen gegen den Krieg
Anmerkungen zum Problem eines Antikriegsfilms
Peter Stettner
Das Etikett Antikriegsfilm erhalten gemeinhin Filme, von denen man annimmt, dass sie den Krieg nicht verherrlichen, sondern anklagen und so zur weiteren Verhinderung von Kriegen beitragen. Die Spielfilmkamera gegen den Krieg zu richten, dies kann nun auf verschiedene Weise geschehen. Sehr selten geschieht es in der Form, dass die Frage nach der Herkunft des Krieges, nach politischen, sozialen und ökonomischen Ursachen gestellt wird.1 Der Regelfall des sogenannten Antikriegsfilms ist der, dass das Kriegsgeschehen selbst im Vordergrund steht. Dabei wird bis in die jüngste Zeit hinein darauf vertraut, dass ein Film desto besser gegen den Krieg einnehme, je realistischer er ihn zeige.2
Auch der Film „Im Westen nichts Neues“ gehört in die Tradition der „realistischen“ Antikriegsfilme, ja er zählt zu den bis heute kaum übertroffenen Klassikern.3 Gegen die Gewissheit der abschreckenden Wirkung dargestellter Kriegsgreuel sind aber auch ernstzunehmende Argumente formuliert worden. So ist der dramaturgische und filmästhetische Lust- und Spannungseffekt ein Merkmal eines jeden Erzählfilms, natürlich auch des Kriegs- bzw. Antikriegsfilms: die Entwicklung des/der Helden wird mit Spannung verfolgt, wie wird die (Film)geschichte wohl ausgehen etc. Und es gibt auch eine Faszination des Grauens: Der Blick auf zerstückelte und brennende Menschen ist leider nicht nur von Entsetzen geprägt, sondern häufig auch von Schaulust.4 Wie es ein bekannter Filmkritiker formulierte: „Der Zuschauer, der das abgebildete Kriegsgeschehen ohne Gefahr für die eigene Person betrachtet, wird zum Voyeur des Massaker. Eher würde ihn das Reißen des Filmstreifens aufstören als das Krepieren eines Mannes auf der Leinwand.“5
Eine weitere kritische Überlegung rückt die Bedeutung des jeweils unterschiedlichen Rezipienten in den Vordergund: Denn die Assoziationen, die ein sogenannter Antikriegsfilm auslöst, sind nicht bei allen Menschen gleich, sondern „können abhängig sein von eigenen Erfahrungen, können situationsbedingt sein, generations- und schichtenspezifisch, den Wandlungen vom gesamtgesellschaftlichen Klima unterworfen. Das bedeutet nicht, dass jeder Film unbegrenzt interpretierbar ist. Die Grenzen liegen in den filmästhetischen Mitteln, deren Wirkung nicht beliebig veränderbar ist.“6
Diese Überlegungen gelten grundsätzlich auch für „Im Westen nichts Neues“, auch wenn dieser Film – anders als die meisten Filme, die Kriegsgeschehen auf die Leinwand bringen – die Kriegshandlungen ohne jegliche Beschönigungen zeigt. Vor allem die Sequenzen Nr. 15 (Aufbau von Stacheldraht, Granatbeschuss), Nr. 19 (Trommelbeschuss im Schützengraben und im Unterstand), Nr. 21 (Schützengrabenkampf, Attacken und Gegenattacken), Nr. 30 und 31 (Granattrichter-Szene) lassen in diesem Sinne an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Angesichts dieser Szenen ist man sicherlich geneigt zu sagen (und auch ich würde dies spontan tun), dass, so wie hier Kriegshandlungen gezeigt werden, wohl kaum Abenteuerlust und Kriegsbegeisterung gefördert werden. Das Vorführen des Films respektive dieser Sequenzen wird vermutlich dazu beitragen, den Krieg in den Köpfen mit Bildern des Schreckens zu füllen. Einen Automatismus gibt es hier freilich nicht.7 Will man also in der Bildungsarbeit auf Filme, die Kriegshandlungen zeigen, nicht grundsätzlich verzichten, so bleibt in diesem Zusammenhang nur, sich dieses Problems bewusst zu sein, die Reaktionen der Betrachter zu beobachten und diese – auch wenn sie nicht den eigenen Erwartungen entsprechen – zu thematisieren und diskutierbar zu machen.
Es soll an dieser Stelle noch ein anderer Weg erwähnt werden, wie ein Film gegen den Krieg aussehen kann: der Film über den Krieg, der im eigentlichen Sinne keine Kriegshandlungen zeigt: stattdessen werden die Folgen und Auswirkungen des Krieges, das was der Krieg aus den Menschen macht, zum Thema.8 Als Beispiel für diesen Weg scheint mir der russische Film „Iwans Kindheit“ aus dem Jahre 1961 (Regie: Andrej Tarkowskij) besonders geeignet. Er zeigt die Zerstörungen und Verstörungen der Menschen, vor allem des jäh in den Krieg gestoßenen Jungen Iwan, ohne spektakuläre Kriegshandlungen. In traumhaften Gegenbildern erscheint ihm und dem Zuschauer die verlorene friedliche Welt, wodurch wiederum die Zeichnung der zerstörerischen Kriegswelt noch schärfer wird.9 Der Gedanke, nicht Kriegshandlungen und Zerstörungen selbst zu zeigen, sondern das erfüllte, von der Zerstörung bedrohte Leben, liegt auch der radikalen Überlegung Rainer Ganseras zugrunde, wenn er formuliert: „Will man im gegenwärtigen Kino so etwas wie ‚Anti- Kriegsfilme‘ suchen, würde ich Filme von Eric Rohmer benennen. Nicht, weil der Krieg in ihnen vorkommt (er kommt es nicht, d. V.), sondern weil Rohmers Ästhetik, seine Inszenierung, sein Umgang mit Menschen, Darstellern, Landschaften und Dingen von einem Respekt durchdrungen sind, der dem militärischen Blick völlig entgegengesetzt ist. Der militaristische Blick erfüllt sich in objekthafter Erfassung und in der Einverleibung der Dinge in eine Rhetorik, worin sie zu bloßem Material werden. Die Intentionalität des Blickes von Rohmer ist aber so, dass sie die Intentionalität des Angeblickten respektiert.“10
Quellenangaben
2. Vgl. etwa Jeanine Basinger, The World War II combat film, New York 1986.
3. Vergleichbar wären in diesem Punkt noch „Westfront 1918“, ebenfalls aus dem Jahr 1930 unter der Regie von G.W. Pabst, und „Wege zum Ruhm“ („Path of glory“) aus dem Jahre 1957 von Stanley Kubrick.
4. Sieht man in „Im Westen nichts Neues“ in einer der Kampfsequenzen vielleicht auch so die abgerissenen Hände, die noch im Stacheldraht hängen?
5. Enno Patalas, Godards Film vom Kriege, in: Filmkritik 5/1965, S. 261.
6. Irmgard Wilharm, Über die Schwierigkeiten der Darstellung von Krieg im Film, in:Beiträge aus der evangelischen Militärseelsorge, Sonderdruck 1990: Militär und Kirche, hg. vom Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr, Bonn 1990, S. 75.
7. Vgl. auch Sequenzprotokoll im Anhang.
8. Leider gibt es keine größeren Untersuchungen zum Rezeptionsverhalten von Krieg/Gewalt im Film. Einzelne Rückkopplungen zu verschiedenen Filmen, die als Antikriegsfilme etikettiert werden, zeigen aber, daß keineswegs immer der gewünschte Abschreckungseffekt erzielt wird. Walther Schmieding weist etwa auf die widersprüchliche, ja zum Teil von „sportlicher Begeisterung“ getragene Reaktion Jugendlicher hin, die den Film „Die Brücke“ von Bernhard Wicky (1959) gesehen hatten. Vgl. Walther Schmieding, Kunst oder Kasse – Der Ärger mit dem deutschen Film, Hamburg 1961, S. 52. In Ansätzen ist dies auch in dem Film „Im Westen nichts Neues“ der Fall. Der Krieg verändert die jungen Leute, soweit sie den Krieg überhaupt überleben. Im Vordergrund steht hier allerdings die Abkehr von dem Hurra-Patriotismus, der zu Anfang des Films inszeniert wird.
9. Vgl. ausführlicher zu dem Film: Peter Stettner, Iwans Kindheit – kein Kriegsfilm,aber ein Film gegen den Krieg, in: Beiträge aus der evangelischen Militärseelsorge, Sonderdruck 1990: Militär und Kirche, hg. vom Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr, Bonn 1990, S. 67 – 74.
10. Rainer Gansera, „Krieg und Geilheit, die bleiben immer in Mode“ (Shakespeare), in: Kino und Krieg. Von der Faszination eines tödlichen Genres (ArnoldsheimerFilmgespräche Band 6), hg. von der evangelischen Akademie Arnoldsheim und dem Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik e.V., Frankfurt/M. 1989, S. 36.
Ein Film – verschiedene Versionen
Zensurkämpfe sind politische Machtkämpfe
Zensur und Manipulation von „Im Westen nichts Neues“: Chronologie
Verarbeitung von Kriegserlebnissen im Film
Bilder vom Krieg – Rückkehr der Erinnerungen
Die Weimarer Gesellschaft und der Krieg im Unterricht
- Unterrichtsvorschläge
- Kontinuität und Wandel – ein Unterrichtsprojekt aus vordigitalen Tagen
- Nachdenken über Krieg und Frieden
Anklagen gegen den Krieg
Anmerkungen zum Problem eines Antikriegsfilms