Kinder, Mütter und ein General (1955)
Annotation
Der Antikriegsfilm „Kinder, Mütter und ein General“ (1955) von László Benedek spielt im Zweiten Weltkrieg. Mütter suchen ihre Söhne, die als Jugendliche in den Krieg gezogen sind. Sie treffen auf desillusionierte Soldaten und mit Hilfe eines älteren Soldaten verstecken sie sich und ihre Kinder, um die Jungen vor dem sinnlosen Tod zu retten.
Inhalt
Im Film geht um vierzehn- bis sechzehnjährige Schüler, die aus ihrem Schulheim an die Ostfront entlaufen sind, um dort „die Russen aufzuhalten“. Fünf Mütter und eine Schwester machen sich auf den Weg an die Front, um die Jungen zurückzuholen. Weder der General noch der Hauptmann der Kampfgruppe Dornberg können die Frauen zurückhalten. Als es diesen nicht gelingt, die Kinder, die sich als Soldaten fühlen, zurückzubringen, bleiben sie selbst an der Front. Ein russischer Angriff führt zur Einschließung der Truppe, und der Hauptmann durchbricht — entgegen seinem Befehl, die Stellung unbedingt zu halten — mit den Frauen und Kindern die russischen Linien in Richtung Westen. Er wird von dem General unter Arrest gestellt, vom Kriegsgericht bedroht, aber schließlich wieder mit der Truppe an die Front geschickt, um eine aussichtslose Stellung zu halten. Die Frauen verstecken die Kinder, um sie vor dem Transport an die Front zu bewahren.
In der ursprünglichen Fassung, die im Ausland gezeigt wurde, bleiben die Frauen allein zurück, während die Kinder mit dem Transport an die Front gehen. Der Filmverleih Schorcht hielt diese Version für die deutschen Zuschauer für nicht akzeptabel und wurde in dieser Meinung von Kinobetreibern noch bestärkt. (vgl. Der versöhnliche Ausklang, in: Der Spiegel, 8. März 1955)

| Produktionsland | Deutschland |
| Erscheinungsjahr | 1955 |
| Länge | 109 Minuten |
| Altersfreigabe | FSK 12 |
| Stab | |
| Regie | László Benedek |
| Drehbuch | László Benedek |
| Produktion | Intercontinental-Film, München (Erich Pommer, Heinz-Joachim Ewert) |
| Musik | Werner Eisbrenner |
| Kamera | Günther Rittau |
| Schnitt | Anneliese Artelt |
|
DarstellerInnen |
|
|
|
Auszeichnungen
- Therese Giehse wurde 1955 mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie Beste Darstellerin ausgezeichnet.
- 1956 wurde der Film mit dem Golden Globe Award in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet.
- Die Filmbewertungsstelle der Länder verlieh dem Film das Prädikat „wertvoll“.
- Von der Evangelischen Filmgilde wurde der Film als „bester Film des Monats“ (Februar 1955) empfohlen.
Der Stoff geht auf eine Kriegserfahrung zurück, die Herbert Reinecker zu einem Roman für die Illustrierte „Quick“ verarbeitete und 1953 als Buch veröffentlichte. Auch mit dem harmloseren Schluß war der Film ein ökonomisches Fiasko. Zu groß war die Diskrepanz zu den anderen deutschen Kriegsfilmen vom Typ CANARIS, die letztlich entlastend wirkten.
Der Regisseur Laslo Benedek, 1907 in Ungarn geboren, ging 1933 nach Wien, dann nach Paris und London und 1937 nach Hollywood, wo er mit „Tod eines Handlungsreisenden“ einen großen Erfolg feierte. Als sich Eric Pommer entschloß, den Stoff von Reinecker in seine Produktionsgesellschaft Intercontinental zu übernehmen, war Benedek sofort bereit, Regie zu führen. Auch Pommer war nach großen Erfolgen am Ende der Weimarer Republik 1933 emigriert und arbeitete in Hollywood und in England. 1946 bis 1949 war er Filmbeauftragter der amerikanischen Militärregierung für Deutschland und gründete 1951 seine eigene Produktionsfirma.
Gedreht wurde das Kriegsgeschehen in Walsrode, Fallingbostel und in der Lüneburger Heide. Tatsächlich kamen englische Panzer bei den Dreharbeiten zum Einsatz. Dazu wurden rund 35 junge Männer vom Bundesgrenzschutz als Statisten verpflichtet.
Obwohl finanziell ein Misserfolg, wurde der Film gerade im Ausland mit Begeisterung von der Kritik gefeiert und erhielt u.a. den Golden Globe.

(…) Reineckers Roman endete harmloser als die beiden Filmfassungen. Am Schluß des Romans gibt es eine militärische Ehrung für die jugendlichen Soldaten. Das Problem der Befehlsverweigerung beim Verlassen der eingeschlossenen Stellung wird entschärft, weil sich herausstellt, daß der General per Funkspruch, der aus technischen Gründen nicht ankam, sogar den Ausbruch befohlen hatte, der Hauptmann also unwissentlich einen Befehl ausgeführt hatte. In dem von Benedek und Reinecker verfaßten ursprünglichen Drehbuch wird die Befehlsverweigerung als solche bestraft und der Hauptmann mit seiner Truppe und den Jungen in eine aussichtslose Stellung abkommandiert. Die Mütter bleiben zurück mit den Worten: „Sie haben uns vergessen, sie werden uns immer vergessen.“ Die Botschaft von der Sinnlosigkeit und Unmenschlichkeit des Krieges ist in dieser Fassung eindeutig. In der Originalfassung bekam der Film den Preis der Kritiker in Belgien und in Hollywood.
Die für das westdeutsche Publikum verharmloste Schlußfassung läßt die Kinder in einer Scheune versteckt vom Transport an die Front verschont bleiben. Die Mühe der Frauen wird damit belohnt, die Botschaft der totalen Sinnlosigkeit des Krieges entschärft. Damit ändert sich der Stellenwert des Dialogs zwischen Hauptmann Dornberg und dem General über den Sinn eines Befehls und des militärischen Gehorsams. Was in der Originalfassung mit der Abkommandierung der Soldaten und Kinder in eine unhaltbare Stellung als blanker Zynismus erschien, wird zur ernsthaften Gegenposition zu den sonstigen Aussagen des Films. Bei der Auseinandersetzung mit Hauptmann Dornberg über dessen befehlswidriges Verlassen der Stellung sagt der General, daß der Krieg auf jeden Fall verloren sei. Darauf der Hauptmann: „Wenn wir das wissen, kann man da noch Menschen umkommen lassen? Hundertfünfzig, für die ich die Verantwortung habe, und zehntausend, deren Schicksal Sie in der Hand haben?“ „In der Hand haben — was Sie auch sagen, Dornberg, wir können nicht einfach aus dem Gesetz heraustreten, Sie nicht und ich nicht.“ Die letzten Worte des Generals lauten: „Die Division geht nicht zurück!“ Der Film wird damit in sich brüchig, ungleichgewichtig. Das stellt auch die Evangelische Filmgilde fest, die den Film zum besten des Februar 1955 erklärt, aber zugleich sagt, daß ein „bester Film“ nicht in jeder Hinsicht gut sein muß. Der Einwand: „Der Filmtitel ,Kinder, Mütter und ein General‘ läßt vermuten, daß diese Gruppierung die Träger der dramatischen Handlung bezeichnet. Aber die Mütter haben keinen echten Gegenspieler. Der General ist es nicht, er hat im Gesamtgeschehen nur eine untergeordnete Funktion: Er, wird zuerst von den Müttern, dann von Dornberg überspielt, aber nicht überwunden. Ein Vergleich etwa mit Canaris in dem gleichnamigen Film macht den Unterschied deutlich.“ Was hier kritisiert wird, trifft die ursprüngliche Aussage des Films, daß Krieg an sich sinnlos und zerstörerisch sei, was durch keinen General geändert werden könne. Im Film trifft ein Leutnant, der von sich sagt, daß er nicht mehr lachen kann (Klaus Kinski), mit einem Trupp versprengter Soldaten in einer provisorischen Unterkunft auf die Frauen, die an die Front wollen. Er sagt ihnen: „Es gibt ’ne Menge Ärger, der kommt nicht von Generälen, der kommt vom Krieg an sich.“ Als ein junger Deserteur in Zivilkleidung vorgeführt wird, nimmt die resolute Handwerkerfrau Bergmann (Therese Giehse) für ihn Partei: „Der hat doch Recht, daß er Schluß machen will! Alle wollen nach Hause, auch unsere Kinder sollen nach Hause, alle wollen endlich mal nach Hause!“ Das zustimmende Lachen der Soldaten verstummt, als der Deserteur gegen den Protest der Frauen erschossen wird. Das letzte Wort im Film haben die Frauen, als die Soldaten zur Front zurückgebracht werden: „Herrgott im Himmel, da fahren sie nun hin!“ „Lassen Sie Gott aus dem Spiel. Die Menschen sind es, immer nur die Menschen.
Der Film bietet kaum Möglichkeiten, dem Krieg einen Sinn zu verleihen. Zwei sich anbahnende Liebesgeschichten, die aber mit dem Rücktransport der Soldaten an die Front keine Chance haben, ändern nichts an der Gesamtaussage. Die Gesprächsempfehlungen der Evangelischen Filmgilde nennen unter drei Aspekten als ersten und wichtigsten den „Gehorsam gegen das Gesetz und die Vernunft. Die Schlüsselfiguren sind der General auf der einen, die Frauen auf der anderen Seite. Aber mit der Vernunft mischt sich bei ihnen schon die Mutterliebe. Der Leutnant, der Deserteur, der Hauptmann sind mit dem Begriff Vernunft nicht mehr zu fassen“.Das militärische Prinzip behält im Film Gültigkeit und wird selbst mit dem geänderten Schluß nicht mehr zum reinen Zynismus. Es gibt im ganzen Film nur anständige Menschen, auch keinen Nazi. Es wird nichts von den Ursachen des konkreten Krieges gesagt, auch nichts davon, daß halbwüchsige Jungen nicht nur aus Abenteuerlust zum letzten Aufgebot kamen, sondern eingezogen wurden. Diese entlastenden Züge teilt der Film mit den anderen deutschen Militärfilmen. Damit hätte er angesichts der Starbesetzung und der guten Inszenierung eigentlich auch für Deutsche attraktiv sein können, er war es aber nicht. Drehbuchautor Reinecker schreibt in seinem erinnernden „Zeitbericht“ 1990: „Benedek machte den Film, sah deutsche Soldaten so, wie er sich deutsche Soldaten vorstellte. In Bewegung, Benehmen und Diktion entsprachen sie nicht dem Bild, das ja viele noch kannten, so kam ein merkwürdiger Verfremdungseffekt hinzu, der erst nach dreißig Jahren verschwunden war, weil die Verfremdung nun allgemein war. Der Film bekam phantastische Kritiken, aber die Leute sahen ihn sich nicht an. Sie wollten ihn nicht sehen. Sie wollten keine Soldaten mehr sehen.“17 Daß die Deutschen keine Soldaten mehr sehen wollten, ist angesichts der Kassenerfolge anderer Kriegsfilme offensichtlich falsch. Reinecker selbst schrieb fast gleichzeitig das Drehbuch zum Massenerfolg „Canaris“. Richtig dürfte dagegen die Annahme eines Verfremdungseffektes sein, aber weniger wegen Diktion und Benehmen, als vielmehr, weil der Film aus der Distanz der Emigration einige Grundzüge deutscher Produktionen nicht teilte, trotz aller Zugeständnisse an ein westdeutsches Publikum keine Sinngebung des Sinnlosen versuchte und keine sentimentale Opferstilisierung betrieb. In der „Deutschen Soldatenzeitung“ vom 14. Mai 1955 wird ein Selbstverständnis formuliert, das für Kriegsteilnehmer damals größere Repräsentativität hatte, als die Zeitung sie sonst für westdeutsche Bevölkerung beanspruchen konnte: „Wir wollen keinen Krieg! Wir glauben aber nicht, daß unser Kampf gerade* in diesen furchtbaren Schlußtagen nutz- und sinnlos war. Wir glauben vielmehr, daß wir durch unseren Einsatz viele Menschen gerettet haben und dadurch ein Weiterleben im größeren Sinne erst möglich wurde. Nach dem Film hätten wir unsere Gewehre wegwerfen und nach Hause gehen müssen.“ Daß diese Vorstellung der lebensnotwendigen Verteidigung gegen Osten im Kalten Krieg der 50er Jahre Resonanz fand, ist nicht verwunderlich; daß sie bis in die Tage des sogenannten Historikerstreits fortlebte, schon eher.“
Auszüge aus: Irmgard Wilharm: Filme mit Botschaft und kollektive Mentalitäten in der frühen Bundesrepublik. In: Geschichte als Möglichkeit. Über die Chancen von Demokratie. Festschrift für Helga Grebing. Hrsg. v. Karsten Rugolp/Christl Wickert, Essen 1995, S: 290-306, hier: S. 303-306

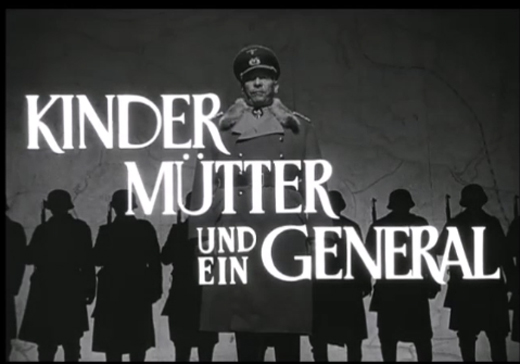
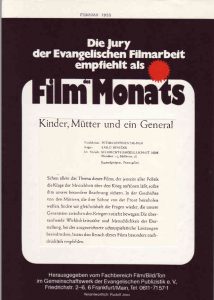 Schon allein das Thema dieses Films, der jenseits aller Politik die Klage der Menschheit über den Krieg auftönen läßt, sollte ihm unsere besondere Beachtung sichern. In der Geschichte von den Müttern, die ihre Söhne von der Front heimholen wollen, finden wir gleichnishaft die Fragen wieder, die unsere Generation zwischen den Kriegen zutiefst bewegen. Die überraschende Wirklichkeitsnähe und Menschlichkeit der Darstellung, bei der ausgezeichnete schauspielerische Leistungen beeindrucken, lassen den Besuch dieses Films besonders nachdrücklich empfehlen.
Schon allein das Thema dieses Films, der jenseits aller Politik die Klage der Menschheit über den Krieg auftönen läßt, sollte ihm unsere besondere Beachtung sichern. In der Geschichte von den Müttern, die ihre Söhne von der Front heimholen wollen, finden wir gleichnishaft die Fragen wieder, die unsere Generation zwischen den Kriegen zutiefst bewegen. Die überraschende Wirklichkeitsnähe und Menschlichkeit der Darstellung, bei der ausgezeichnete schauspielerische Leistungen beeindrucken, lassen den Besuch dieses Films besonders nachdrücklich empfehlen.

