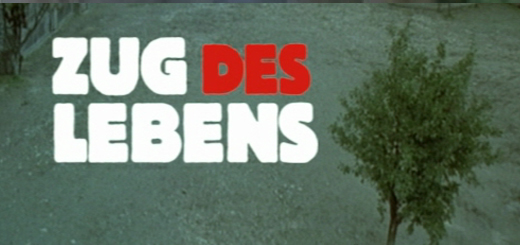Der Ruf (1949)
von GFS-Admin_2021 · Veröffentlicht · Aktualisiert
Annotation
Der Film von Josef v. Baky nach einer Idee und dem Drehbuch von Fritz Kortner thematisiert die Schwierigkeiten der Remigration im Nachkriegsdeutschland. Der jüdische Professor Mauthner kehrt aus dem US-Exil nach Deutschland zurück, um an seine alte Universität zurückzukehren. Dort stößt er auf Ablehnung, Antisemitismus und alte Feindbilder.
Autoren/Innen
Filmanalysen: Autorengruppe Nachkriegsspielfilme (1993), Bettina Greffrath (1993)
Zusammenstellung und Bearbeitung der Materialien: Autorengruppe Nachkriegsspielfilme (1993); aktualisiert: Detlef Endeward (2021/23)
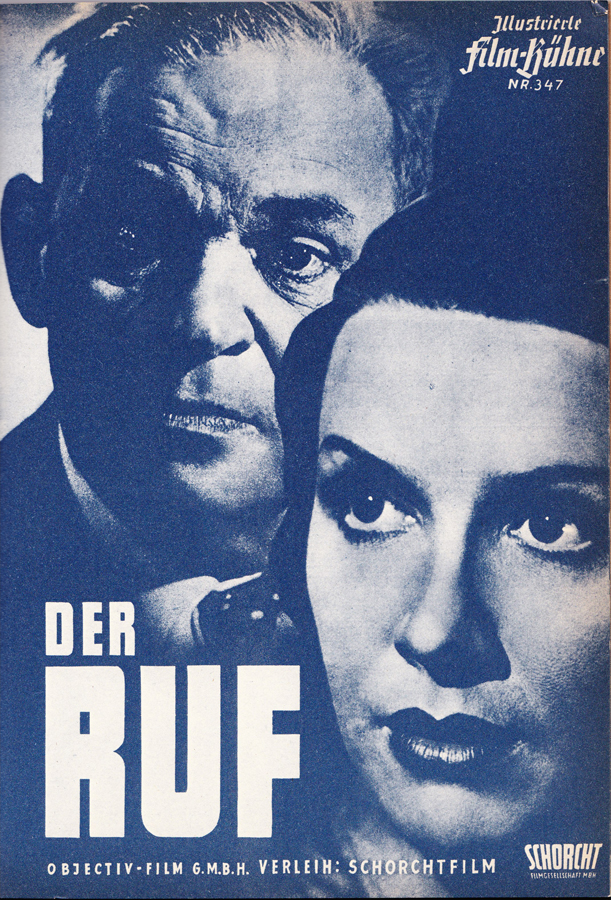
Allgemeine Angaben
- Titel: Der Ruf
- Produktionsland: Deutschland (West)
- Produktionsjahr: 1948/1949
- Genre: Spielfilm
- Sprache: Deutsch
- Länge: 2.850 Meter / ca. 104 Minuten
- Format: 35mm
- Seitenverhältnis: 1:1,37
- Bild/Ton: Schwarzweiß / Tonfilm
Technische Daten
- Regie: Josef von Baky
- Regieassistenz: Wolfgang Becker
- Drehbuch & Idee: Fritz Kortner
- Kamera: Werner Krien
- Schnitt: Wolfgang Becker
- Ton: Walter Rühland
- Musik: Georg Haentzschel
- Bauten: Fritz Lück, Fritz Maurischat, Hans Sohnle
Darsteller:innen (Auswahl)
- Fritz Kortner – Professor Mauthner
- Rosemarie Murphy – Mary
- Johanna Hofer – Lina
- Lina Carstens – Emma
- William Sinningen – Elliot
- Michael Murphy – Spencer
- Ernst Schröder – Walter
- Paul Hoffmann – Dr. Fechner
- Arno Assmann – Kurt
- Charles Regnier – Bertram
- Alwin Edwards – Homer
- Harald Mannl – Professor Fränkl
- Friedrich Domin – Professor Helfert
- Hans Fitz – Rextor
- Otto Brüggemann – Dekan
- Weitere: Johannes Buzalski, Annemarie Holtz, Robert I. Charlebois, Hans Clarin, Walter Janssen, u.v.m.
Produktionsdetails
- Produktionsfirma: Objectiv-Film GmbH (München)
- Produzent: Josef von Baky
- Produktionsleitung: Richard König
- Drehort: Bavaria-Atelier München-Geiselgasteig
Prüfung & Aufführungen
- Zensurprüfung: April 1949 (Alliierte Militärzensur)
- Uraufführung: 19. April 1949, Berlin (Marmorhaus)
In der Emigration in Kalifornien erhält Professor Mauthner den Ruf, als Philosophieprofessor an seine alte Universität Göttingen zurückzukehren. Seine amerikanischen Freunde raten ihm ab, aber er reist trotzdem mit seinen jüngeren Mitarbeitern über Paris zunächst nach Berlin. Dort trifft er seine geschiedene Frau, die ihm erzählt, dass ihr gemeinsamer Sohn in Kriegsgefangenschaft sei. Aus dem Gespräch zwischen dem jüdischen Professor und seiner nichtjüdischen Frau wird deutlich, dass sie, in der Hoffnung, damit den Sohn zu schützen, einen Nationalsozialisten geheiratet hat. Der Sohn ist nicht in Kriegsgefangenschaft, sondern Mitglied einer Gruppe junger Studenten, die unter Anführung des neiderfüllten, ehrgeizigen und nach wie vor der nationalsozialistischen Ideologie anhängenden Kollegen Fechner den zurückgekehrten Emigranten boykottieren und vertreiben wollen. Als Professor Mauthner in Göttingen seine Antrittsvorlesung hält, die, ausgehend von Plato, eine Antikriegsrede ist und sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt, gibt es feindselige Reaktionen und, anläßlich eines Mauthner zu Ehren stattfindenden geselligen Abends, offen antisemitische Äußerungen. Der ohnehin kranke Professor stirbt an den Folgen der Aufregung über diese Vorgänge in dem Moment, in dem sein Sohn sich von der nationalsozialistischen Gruppe trennt und seine Frau zu ihm zurückfindet. Dem Trauerzug schließt sich auch einer der Fechner-Anhänger an.
Nr. |
Inhalt |
Länge |
Zeit im Film |
|
1 |
Vorspann. Straßenszenen in Los Angeles. Der farbige Hausdiener Homer trifft im Haus von Professor Mauthner ein. In der Küche sind die Vorbereitungen für die Party im Gange. Emma schwärmt vom Deutschland der Kaiserzeit. Mauthners Assistenten Mary, Elliot und Spencer treffen ein. Hausmusik, Gespräche der Partygäste. Homer singt eine Arie. |
9.40 |
0.00 – 9.40 |
|
2 |
Gespräch Mauthners mit einem Freund im Separé. Mauthner berichtet ihm von dem Ruf an die Universität Frankfurt und seine widerstreitenden Gefühle zur Frage seiner Rückkehr nach Deutschland. |
4.29 |
9.40 – 14.09 |
|
Während das Schreiben in geselliger Runde verlesen wird, redet Mauthners Freund Mary zu, Mauthner umzustimmen. Mauthner versucht, die Party wiederzubeleben. In der Küche teilt Mary der aufgeregten Emma ihre Einschätzung mit, dass Mauther die Entscheidung zur Rückkehr bereits gefällt hat. Unter den Partygästen kommt es zum Streitgespräch über das Wesen der Deutschen („Menschenfresser“). Mauthner ergreift Partei für die Deutschen, die den Massenmord nicht verhindert haben. Morgens: Emma bringt Kaffee und fragt in die Runde, ob sie ein Menschenfresser sei. |
6.25 |
14.09 – 20.34 |
|
|
4 |
Überfahrt. Gespräch Mauthners mit einem deutsch sprechenden Mitreisenden. Mary sorgt sich um ihn. Gespräch Mauthners mit Elliot und Spencer, die auf Deutschland gespannt sind. Gespräch Mary und Emma in der Kabine: Mary erfährt, daß Mauthner die ganzen Jahre über Päckchen nach Deutschland geschickt hat, die wohl an eine Frau gerichtet waren. Nächtliches Gespräch Emma und Mary, da Mary nicht schlafen kann. |
4.18 |
20.34 – 24.52 |
|
5 |
Ankunft in Europa und Zugfahrt durch Frankreich. Mauthner teilt der Gruppe seinen Entschluss mit, von Paris aus gleich weiterzufahren. Trennung von der Gruppe im Pariser Bahnhof. Mauthner setzt alleine die Reise fort. |
3.16 |
24.52 – 28.08 |
|
6 |
Berlin. Vorbeimarsch amerikanischer Infanteristen und Kavallerie. Zufallsbegegnung Mauthners mit einem zudringlichen alten Bekannten (Fechner), den Mauthner zunächst nicht wiedererkennt. Ein amerikanischer Beamter teilt Fechner mit, daß Mauthner an seiner Stelle die erhoffte Professur erhält. Mauthner besucht alte Bekannte, denen er die eigentlich für Lina gedachten Päckchen zugestellt hatte. Sie können ihm bei der Suche nach Lina nicht weiterhelfen. |
5.14 |
28.08 – 33.22 |
|
7 |
Behördengänge Mauthners auf der Suche nach Lina. Begegnung mit einem Schwarzmarkthändler. In einer Kneipe trifft er schließlich Lina, die ihm mitteilt, ihr gemeinsamer Sohn befände sich noch in Kriegsgefangenschaft. Sie bricht das Gespräch ab, teilt ihm aber ihre Adresse mit. Mauthner trifft noch vor ihr an ihrer Wohnung ein und fängt sie vor der Haustür ab. Da sie die Wohnung mit anderen teilt, schlägt Mauthner vor, das Gespräch in einem Schieberlokal fortzusetzen, von dessen Existenz er durch Fechner erfahren hatte. |
8.58 |
33.22 – 41.20 |
|
Im Schieberlokal. Unter den Gästen sind auch Fechner und seine Ehefrau. Fechner beschwert sich bei einem Amerikaner über Mauthner, der ihm die Professur weggeschnappt habe. Lina und Mauthner treffen ein und setzen ihr Gespräch über den Sohn fort, dem Lina Mauthners Vaterschaft verschwiegen hat. Fechner erkennt Mauthner und verabschiedet sich höflich von ihm. Lina und Mauthner geraten in einen heftigen Streit, in dem sich persönliche und politisch-weltanschauliche Gegensätze vermischen. |
8.50 |
41.20 – 50.10 |
|
|
9 |
Am nächsten Morgen: Lina stattet Mauthner einen Versöhnungsbesuch ab. Unverhofft treffen Emma und Mary in der Wohnung ein, Mauthner stellt ihnen seine Ex-Frau vor. |
4.20 |
50.10 – 54.30 |
|
10 |
Tanzabend in einer Berliner Studentenkneipe: Elliot und Spencer machen die Bekanntschaft deutscher Studenten. |
3.39 |
54.30 – 58.09 |
|
Zugfahrt Berlin nach Frankfurt. Mary sorgt sich um Mauthner, der von zwei jungen Männern aufdringlich beobachtet wird. Einer von ihnen ist Walter. Am Bahnhof erwarten der Hochschuldekan und Fechner die Ankunft des Zuges: Der Dekan begrüßt Mauthner, Fechner die beiden jungen Männer. |
3.27 |
58.09 – 61.36 |
|
|
Antrittsrede Mauthners vor großem Plenum: Rückgriff auf Platon, Ablehnung des Krieges. Bei Ende des Vortrags verläßt die überwiegende Mehrheit der Zuhörer schweigend den Saal, eine Minderheit applaudiert begeistert. Mary macht Walters Bekanntschaft. Fechner beschwert sich bei Walter über das Ausbleiben des geplanten lautstarken Protestes gegen Mauthner. |
7.53 |
61.36 – 69.29 |
|
|
13 |
Besprechung der Antrittsrede im Kollegium: Ein Empfangsabend für Mauthner wird angekündigt. Im Gespräch mit einem Kumpan stellt sich Walter als Linas Sohn heraus. Emma und Mauthner am Mittagstisch. Vor dem Bierkeller: Walter und Mary küssen einander. |
5.17 |
69.29 – 74.46 |
|
Empfangsabend im Bierkeller. Fechner spielt sich vor seinen Studenten auf und erntet Beifall für antisemitische Entgleisungen. Ein Anhänger Mauthners mischt sich ein, woraufhin es zu Handgreiflichkeiten und zur Saalschlacht kommt. Mauthner kann durch sein persönliches Auftreten die Ausschreitungen beenden, sieht sich aber ganz offen mit dem Haß seiner Gegner konfrontiert. |
7.31 |
74.46 – 82.17 |
|
|
15 |
Lina liest in der Zeitung von den Vorfällen in Frankfurt und von der Verstrickung ihres Sohnes. Konspiratives Treffen der Antisemiten im Bierkeller: Wegen der Suspendierung Fechners werden weitere Schritte gegen Mauthner geplant und Walter angestiftet, seinen Kontakt zu Mary auszunutzen, um in die Nähe Mauthners zu gelangen. |
3.12 |
82.17 – 85.29 |
|
16 |
Walter sucht Mary auf, um mit ihrer Hilfe ein Treffen mit Mauthner zu arrangieren. Lina sucht Walther auf, kann ihm jedoch nicht die Wahrheit über seinen Vater sagen, da Fechner gerade bei ihm ist. Aztbesuch bei Mauthner, den seine körperliche Schwäche ans Bett fesselt. Diskussion mit Emma, die eine baldige Abreise befürwortet. |
6.11 |
85.29 – 91.40 |
|
17 |
Lina erscheint an Mauthners Krankenbett. Mauther bittet sie zu bleiben, sodaß Lina dem geplanten Treffen mit Walter fortbleiben muß. |
4.13 |
91.40 – 95.53 |
|
Emma lässt Walter ein. Ohne seine Mutter zu bemerken, tritt er an das Bett Mauthners und bittet diesen um Entschuldigung. Der vor sich hindämmernde Mauthner nimmt aber seine Umwelt kaum noch wahr. Eine Montage veranschaulicht Gedanken und Erinnerungsfetzen des sterbenden Mauthner. Walter tröstet seine Mutter am Totenbett des Vaters. |
4.49 |
95.53 – 100.42 |
|
|
19 |
Einer aus Fechners Gruppe schließt sich dem Trauerzug für Mauthner an. |
0.48 |
100.42 – 101.30 |
Einer der wenigen beeindruckenden Filme der westlichen Produktion in der Nachkriegszeit
Autorengruppe Nachkriegsspielfilme (1993)
Der nach einem Drehbuch von Fritz Kortner inszenierte Film nimmt sowohl von der Thematik als auch in der Darstellungsperspektive eine Sonderstellung unter den deutschen Nachkriegsspielfilmen ein. Er schildert das Schicksal eines emigrierten jüdischen Philosophieprofessors, der dem Ruf an seine alte Universität in Deutschland gegen den Rat seiner Freunde folgt, dort mit antisemitischen Reaktionen konfrontiert wird und scheitert.
Für gewöhnlich gilt der Regisseur als der – maßgebliche – Schöpfer eines Films. Er ist es, der die künstlerischen Anteile des Kameramannes und des Drehbuchautors, des Schauspielers und des Beleuchters, des Bühnenarchitekten, Tonmeisters und Cutters zu einem koheränten Ganzen zu fügen hat. Was einen Filmregisseur jedoch zu einem Filmregisseur macht und nicht zu einem bloßen Organisator und Koordinator der unterschiedlichen filmkünstlerischen Aufgabenbereiche, das ist die Ausprägung einer eigenen Handschrift, die erst, gleich einer Komposition, die vielfältigen filmischen Ausdrucksmittel im „Gesamtkunstwerk“ Film mit- oder gegeneinander zu einer (Wechsel-)Wirkung formt.
1948/49 übernahm Josef von Baky die Regie des so gar nicht zeitgemäßen Nachkriegsfilms DER RUF. Aber dieser Film ist eben auch nicht ein Film von Josef von Baky, es ist vielmehr der seines Drehbuchautors und Hauptdarstellers Fritz Kortner, einer, der sich – zeit seines Lebens – nicht arrangierte; der 1933 als gefeierter Film- und Theaterschauspieler Deutschland verließ und über die Schweiz und Großbritannien in die USA emigrierte; der 1948 zurückkehrte und nun, vor allem als Regisseur, in unbequemen und provozierenden Theaterinszenierungen der deutschen Nachkriegsgesellschaft unerbittlich den Spiegel vorhielt, so dass er in den 60er Jahren für eine neue Generation von Theaterregisseuren wie Ivan Nagel, Peter Stein und Peter Zadek zum väterlichen Vorbild wurde.
DER RUF war Kortners erste künstlerische Arbeit in Deutschland nach seiner Rückkehr. Eigentlich hatte er von dem Intendanten Wolfgang Langhoff und dem Chefdramaturgen Herbert Ihering einen „Ruf“ an das deutsche Theater in Berlin erhalten, um dort im „Don Carlos“ den König Philipp zu spielen.
In seiner Kortner-Biografie berichtet Klaus Völker: „Am 21. Dezember 1947 traf Kortner, von Zürich über Frankfurt kommend, in Berlin ein. Als amerikanischer Staatsbürger mußte er sich hier nun unerwarteterweise an die OMGUS-Bestimmungen halten. Da das Deutsche Theater im Ostsektor der Stadt lag, kam ein Auftreten Kortners dort schon gar nicht in Betracht. Aber auch die Pläne mit dem Hebbel-Theater, wo er dann als Schauspieler und Regisseur eines amerikanischen Stückes in Erscheinung treten sollte, ließen sich 1948 nicht verwirklichen: Jede Art von `trading with the enemy´ wurde ihm untersagt. Warum die Amerikaner Kortner diese Schwierigkeiten machten, wer hier gegen ihn arbeitete, nachdem Eric Pommer und sogar der amerikanische Kulturoffizier Benno Frank zu seinen Gunsten interveniert hatten, blieb im Dunkeln. Kortner hätte damals seine amerikanische Staatsbürgerschaft aufgeben und in den Ostsektor `überlaufen´ müssen, um spielen zu können. Die Amerikaner boten ihm als Ersatz schließlich einen Film an. […]“[1]
DER RUF wurde mit amerikanischen Finanzmitteln produziert: er sollte der „Reeducation“ dienen. Kortner notierte dazu in seinen Memoiren „Aller Tage Abend“:
„Pommer, der allmächtige Filmmann der zwanziger Jahre, nun beamteter amerikanischer Leiter der Abteilung für Film, brachte die Produktion eines Films, mit amerikanischer Finanzhilfe, zustande, der sich gegen den schon damals da und dort auflebenden Neofaschismus und den zum Teil noch unbeseitigten Antisemitismus wenden sollte. Ich lieferte die Idee und schrieb das Drehbuch; die `von Baky und König-Filmgesellschaft´ engagierte mich für die Hauptrolle und Hanna (Kortners Frau, d. V.), die inzwischen eingetroffen war, als meine Partnerin.“[2]
Kortners Drehbuch zu dem Film verarbeitet seine Lebenserfahrungen in der Emigration und formuliert seine persönliche Haltung zum Hitler-Faschismus und den Anforderungen eines gesellschaftlichen Neubeginns nach 1945: Er verneint die Kollektivschuld, bekämpft jegliche Überreste eines noch vorhandenen Antisemitismus und faschistischer Haltungen, beschwört (vor allem zur Jugend gerichtet) die Chance eines gesellschaftlichen Neuanfangs, bei dem er der `Freiheit des Geistes´ (für Kortner sind das Kunst und Wissenschaft) eine tragende Bedeutung beimißt. Nicht Verdrängung, sondern Verantwortung, für das Geschehene der Vergangenheit und das Kommende der Zukunft, heißt das Wort, an das Kortner die Deutschen in diesem Film gemahnt.
Der Film beginnt in Amerika. Es ist 1948. „Jetzt ist es 15 Jahre her, dass wir uns von drüber wegmachten“, sagt Lina Carstens als Hausangestellte und guter Geist von Professor Mauthner, in dessen Haus sich deutsche Emigranten und amerikanische Freunde und Studenten zu einer kleinen Party versammeln. Es wird musiziert, über Kunst und Deutschland debattiert. Mauthner sitzt in einem zweiten Zimmer abseits und hört der Musik zu. Die Kamera isoliert ihn von dem übrigen Geschehen, das Zimmer ist dunkel, Mauthners Gesicht fast ganz im Schatten verborgen. Fränkl kommt herein und holt ihn aus seinen Gedanken. Mauthner zeigt Fränkl seine Berufung an die Universität Göttingen und erklärt, dass er überlege, nach Deutschland zurückzukehren. Kurze Zeit später, als auch alle anderen von Mauthners Plänen erfahren haben, kommt es zwischen ihm und Fränkl zum Disput (Sequenz 3). Die Musik ist verstummt, in einer halbtotalen Einstellung zeigt die Kamera einen aufgebrachten Fränkl empört zu den Freunden ausrufen: „Und ich sage euch, auch wenn es brutal klingt: Das sind doch Menschenfresser, die da drüben! Kannibalen! Ja, das sind sie! Verspürst du keinen Haß, keinen Abscheu gegen sie?“
Der aus dem Hintergrund herankommende Mauthner antwortet: „In meinen besten Momenten: nein.“
Fränkl, laut und ungehalten, wendet sich ab. „Das versteh ich nicht. Mitgemacht oder zugeschaut haben sie doch alle!“ Die Kamera fährt langsam in einer Ranfahrt aus der Halbtotalen in eine Großaufnahme von Mauthner. Während dieser Fahrt sagt er: „Ich frage dich Fränkl, der du hier so groß angibst, bist du bereit dein Leben zum Schutze anderer, unschuldig Verfolgter, zu riskieren? Es gibt da noch allerlei Gelegenheit auf der Welt. Wenn nicht, dann schweig und verlang’s nicht von anderen. Es gibt weder ein Volk von Verbrechern noch ein Volk von Helden. Was weiß ich, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich hätte drüben bleiben können!“
1959 schreibt Kortner in Erinnerung an diese Zeit:
„Meine Rückkehrabsicht stieß auf die Verdammung der vielen Ankläger gegen Deutschland. Jener erbarmungslos gewordenen Getretenen, Geflohenen, um Vergaste und Ermordete grimmig Trauernden. Meine anders geartete Einstellung zu Deutschland beruhte, von meinem Wunschtraum abgesehen, auf der Erkenntnis, dass jedes Volk unter gewissen sozialen und historisch bestimmten Umständen gleichfalls so entarten könne und ähnlich bestialisch handeln würde. […] Ich war und bin überzeugt davon, dass es keine deutsche Kollektivschuld gibt, jedoch eine Kollektivschuld der machthabenden Kreise in Deutschland, England, Frankreich und Amerika durch die fast komplizenhafte Duldung des Hitlerischen Aufstiegs, seiner Machtergreifung und seiner Raubzüge. […] Ich rüstete mich zur Reise. Die Emigranten standen kopf. Ich verkrachte mich noch schnell mit manchen der unversöhnlichen Hasser. Sie fanden dann später den Weg ins deutsche Wirtschaftswunderland und kamen besser damit zurecht als ich, der ich mit soviel Erwartung gekommen war.“[3]
Mauthner kehrt nach Deutschland zurück. Mit ihm reisen seine Hausangestellte Emma und die drei wissenschaftlichen Assistenten Elliot, Spencer und Mary. Während der Überfahrt steht er allein im grauen Nebel an der Reling. Ein alter Herr gesellt sich zu ihm und fragt nach dem Reiseziel. Mauthner zitiert Heinrich Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“. „Was, nach Deutschland wollen sie?“ fragt ungläubig der Alte, ganz offensichtlich wie Mauthner ein Jude, und wendet sich von ihm ab.
Mauthner entschließt sich, nicht wie die anderen eine Woche in Paris zu verbringen, sondern gleich nach Berlin zu fahren. Eine Naheinstellung zeigt den heimatsuchenden Heimkehrer aus dem Zugfenster in die dunkle Nacht starren. Von Deutschland ist nichts zu sehen.
Im „Headquarter office of military government for Germany“ trifft Mauthner einen ehemaligen Kollegen wieder, der den Emigranten überschwenglich in der „alten Heimat“ begrüßt und im nächsten Satz betont, wie schwer doch die „innere Emigration“ für ihn gewesen sei. Der Kollege läßt Mauthner nicht zu Wort kommen, überhäuft ihn mit Phrasen und geheuchelter Anteilnahme und Freundlichkeit, um am Schluß, nicht ohne Genugtuung gegenüber seinem „alten Kollegen“ herauszustellen, dass er seine Professur erwarte. Mauthner kann sich nicht an den Namen das Bekannten erinnern. Später, im Lokal, als der „Kollege“ erfahren hat, dass nicht er, sondern Mauthner die Professur erhält, und er sich darob zynisch-provokativer Bemerkungen gegenüber dem so freundlich Begrüßten nicht enthalten kann, fällt Mauthner der Name plötzlich wieder ein: Fechner. Er wird aufgrund dieser von ihm empfundenen persönlichen Kränkung in Göttingen die Studenten gegen Mauthner aufwiegeln: Jude, Emigrant und Heuchler sind seine Stichworte, um den Heimgekehrten (erneut) zu diffamieren. Das Tausendjährige Reich gibt es seit drei Jahren nicht mehr, seine Welt- und Menschenbilder existieren jedoch fort – und fallen bei den jugendlichen Studenten durchaus nicht auf unfruchtbaren Boden.
In Berlin trifft Mauthner auch seine ehemalige Frau Lina wieder. Mehr aus Zufall; denn finden konnte er sie (der er all die Jahre Pakete aus den USA geschickt hatte, die aber nie ihr Ziel erreichten) nicht – sie wollte nicht gefunden, nicht mit der Vergangenheit und der Erinnerung an sie konfrontiert werden. Lina hatte nach Mauthners Emigration wieder geheiratet, einen „Arier“, um die jüdische Abstammung ihres gemeinsamen Sohnes zu vertuschen. In einem Schieberlokal kommt es zur mühsamen Aussprache zwischen beiden, die ihm Streit endet. Mauthner will von seinem Sohn wissen, Lina berichtet, sie habe keinen Kontakt mit ihm, er sei in Gefangenschaft. Mauthner hat das Bild eines Babys vor Augen, denkt er an seinen Sohn. In den letzten Jahren trug in seinen Träumen und Phantasien dieses Baby eine Uniform.
Es ist ein langes, schwieriges Gespräch – auch für den Zuschauer – zwischen beiden, in englischer Sprache geführt (Sequenz 8). Die englische Konversation (in sparsamen Untertiteln ins Deutsche übersetzt) zwingt zur Aufmerksamkeit, zum genauen Hinhören. Gleichzeitig schafft sie eine Distanz zwischen Mauthner und seiner früheren Frau, ver- und entfremdet ihre persönliche Geschichte, schafft die fremde Sprache rationale Kälte zwischen den Sprechenden, aber auch zwischen den Filmbildern und den Zuschauern im Kinosaal – eine außerordentliche Filmsequenz im Kino der deutschen Nachkriegszeit. Aus einem zweiten Raum der Gaststätte dröhnen laute Musik und Menschenstimmen zu den beiden herüber: Ablenkung, Vergessen, besinnungsloses Genießen einer breiten Masse andeutend. Die Gesichter von Mann und Frau sind hart ausgeleuchtet, sie sind zur Hälfte in Schatten getaucht. Der ganze Raum ist dunkel, unfreundlich, wirkt armselig, leer und ausgebrannt: ein Bühnenbild als Spiegelbild der in ihm agierenden Menschen. Mauthners Vorwürfe gegen Lina werden härter, seine Stimme lauter. Es ist der beklemmende Versuch einer Verständigung zwischen einer, die blieb und bleiben wollte (weil sie konnte), und einem, der ging, weil er als Jude gehen mußte. Zwischen diesen Polen ist nichts geblieben, alles zerstört, verlorengegangen: Die Gewalt des deutschen Faschismus hat nicht nur Millionen Menschen getötet und Tausende von Städten zerstört, sondern auch die Freundschaft und die Liebe zwischen den Menschen. Was hier entzweit wurde, kann, wenn überhaupt, so schnell nicht wieder heilen.
Mauthner wirft seiner damaligen Frau vor, dass sie faschistischen Idealen angehangen habe. Er bezichtigt sie, wie die meisten Deutschen, schweigend oder schreiend, dem Rassenwahn anheim gefallen zu sein, was seine Verleugnung ihrem gemeinsamen Sohn gegenüber beweise. Lina entgegnet verzweifelt, dass er sie verlassen habe durch seine Emigration, nicht sie ihn. Außerdem habe sie nur das halbjüdische Kind schützen wollen, nicht mehr und nicht weniger, und dazu erschien ihr jedes Mittel recht. „Man kann nicht mit dem Todfeind unter einer Decke leben,“ schreit Mauthner heraus. Auch nicht, wenn es die eigene, geliebte Frau ist. Lina steht vom Tisch auf und geht.
Am nächsten Morgen besucht Lina Mauthner. Beider Zorn hat sich gelegt, aber es wird auch nicht weiter über dieses Vergangene geredet, jede Verständigung erschiene sonst unmöglich. Man ist freundlich zueinander, aber man ist sich auch fremd.
In der Zwischenzeit sind auch Emma, Mary, Elliot und Spencer in Berlin eingetroffen. Gemeinsam fahren sie mit dem Zug nach Göttingen. Es ist wieder Nacht. Von Berlin hat der Zuschauer nicht eine bekannte Straße oder ein größeres Gebäude gesehen: Ein „Wiedererkennen“ Mauthners mit der Heimat findet nicht statt, Identifizierungen mit der Geschichte dieses Landes sind nicht möglich. Das Alte, auch nur materiell nur noch vorhandene, und seien es die Ruinen, ist nicht mehr. Nur in den Menschen lebt es noch fort. Keine Totale zeigt eine öffnende Perspektive, kein einziger Sonnenstrahl dringt in die Filmbilder. In Deutschland ist dunkle Nacht.
Im Zug mustern mit provozierend herabwürdigenden Blick zwei junge Männer Mauthner und Mary in ihrem Abteil (Sequenz 11). Der eine ist. wie sich herausstellen wird, Mauthners Sohn Walter, von Fechner nach Göttingen gerufen, um gegen den ihm unbekannten Vater zu intrigieren. „Die selben Gesichter wie früher“, sagt Mauthner und bittet Mary, sich so zu setzen, dass er die beiden nicht mehr sehen müsse. Die selben Gesichter, die selben (Vor-)Urteile. Wegen der Beziehung Mauthners zu Mary, des alten Mannes zu der jungen Frau, wird Fechner den Professor in Göttingen verurteilen und als schamlos in der Öffentlichkeit darstellen. Seit seiner ersten Begegnung in Berlin war Fechners zweite Frage, frivol und chauvinistisch, an Mauthner gewesen: „Ach übrigens, wie steht’s mit den Frauen? Sie waren doch auch kein Kostverächter.“
In seiner Antrittsvorlesung (Sequenz 12) greift Mauthner das gleiche Thema auf, mit dem er vor 15 Jahren seine Universitätstätigkeit hatte beenden müssen: Ausführungen über Platons Grundbegriff der Tugend. Zuerst ist nur Kortners Stimme zu hören, die Kamera befindet sich im Technikraum des Vorlesungssaales. Die beiden Amerikaner Elliot und Spencer verfolgen von hier aus die Vorlesung. Langsam fährt die Kamera auf ein Fenster zu und schwenkt in den Saal. In dieser totalen Obersicht verharrt sie eine Weile. Mauthners Stimme ist kräftig und energisch, seine Sätze und Wörter sind pointiert und fesselnd. Und doch wirkt Mauthner aus dieser Perspektive klein und verloren, hilflos und verlassen.
Mauthner redet in englischer Sprache, die Muttersprache ist ihm während seiner wissenschaftlichen Tätigkeit in den USA fremd geworden. Und nach 12 Jahren Faschismus sind Wirkung und Macht der deutschen Sprache, die unter Hitler zum gewalttätigen Propagandainstrument wurde, mit Vorsicht und Behutsamkeit zu verwenden. Mit einer vertikalen Fahrt gibt die Kamera ihre distanzierte Obersicht auf und zeigt anschließend in mehreren Schwenkfahrten den vollbesetzten Vorlesungssaal. Mauthner wird in Einzeleinstellungen von seinem Plenum isoliert. Außer Kortners gewaltiger Stimme ist kein Geräusch zu hören. Fechner hatte die Studenten zu lautem Protest aufgerufen. Aber niemand vermag sich zu rühren, auch Fechners junge Gefolgsmänner Walter und Kurt nicht.
Dann hat Mauthner „seine“ Sprache wiedergefunden. Die letzten Sätze seiner Vorlesung spricht er in Deutsch:
„Dunkle Nacht senkte sich über Deutschland. Ihr saht diese Nacht als neuen Tag. Jetzt wollen viele unter euch die Augen nicht öffnen. Ihr nennt den neuen Morgen Dunkelheit. Doch dieser Morgen kann Tag werden. Ihr seid jung, eines Tages werdet ihr erkennen: Manche verlorene Schlacht gibt mehr Anlaß zu Triumph als der Sieg.“
Doch während dieser Sätze hat sich die Kamera längst wieder in ihre totale Obersicht begeben. Beschwörend sind Mauthners Worte, ohnmächtig steht er dort unten hinter dem Rednerpult. Die letzten Warte verhallen, stumm erheben sich die Studenten von ihren Plätzen. Das ist ihr Protest, aber auch ihre Irritation. Als Mauthner den Saal verläßt, klopfen einige Wenige, noch ganz fassungslos über das Geschehene, laut und ausdauernd auf ihre Tische.
Mauthner zu Ehren findet ein geselliger Abend statt (Sequenz 14). Hier kommt es zum Eklat. Fechner, der Alkohol hat ihm endgültig die Zunge gelöst und ihn die Maske ablegen lassen, bemerkt im Kreise seiner Anhänger, das nächste Mal müsse wohl noch gründlicher mit den Juden aufgeräumt werden. Gegen Fechners antisemitische Reden setzt sich ein (jüdischer) Student zur Wehr, und löst mit seiner engagierten Reaktion eine Schlägerei aus. Als Elliot, der in unmittelbarer Nähe Fechners Sätze mithörte, diese seinem einige Tische weiter entfernt sitzenden Professor aufgebracht erzählt, bricht Mauthner in ohnmächtiger Wut zusammen. Zur geplanten Rückreise in die USA (auch Emma ist es in diesem ihr fremdgewordenen Land zu kalt; sie sehnt sich nach der Sonne Kaliforniens) kommt es nicht mehr. Mauthners Lebenskraft ist verbraucht. Die letzten Stunden verbringt er in Gegenwart seiner aus Berlin angereisten Frau. Walter, der sich in Mary verliebt hat und eigentlich für Fechner in Erfahrung bringen soll, ob Mauthners Krankheit „ein weiterer geschickter moralischer Schachzug“ von ihm sei, bittet den schlafenden Mauthner um Verzeihung, als er seine Mutter im Zimmer erblickt. Zusammen wohnen Mutter und Sohn dem Tode ihres Mannes und Vaters bei (Sequenz 18).
Die Schlußbilder des Films sind (und machen) stumm: sprachlos, fassungslos. Naßkalt und grau ist es, als eine kleine Trauergemeinde dem Sarge Mauthners folgt. Keine Musik, kein lautes Schluchzen, nur eisige Kälte übermitteln die Bilder. Am Straßenrand stehen die Unbelehrbaren, ewig Irregeleiteten, allein gelassen von ihrem „Führer“. Nur einer hat verstanden und gelernt. „Ich gehe da mit,“ sagt der junge Charles Regnier in seiner Rolle als Fechner-Anhänger Bertram und folgt dem Trauerzug. Er ist einer der wenigen, die Mauthners/Kortners „Ruf“ doch noch gehört haben.
Es nimmt nicht Wunder, dass ein solch hoher Grad an Beklommenheit und Betroffenheit in der Wirkung der düsteren Bilder dieses Films von den deutschen Kinozuschauern im Jahre 1949 nur höchst unwillig akzeptiert wurden. Zerstörten diese Bilder doch zu nachhaltig die wiedergewonnenen Zukunftsperspektiven, erinnerten sie unnachgiebig an das nun schon seit vier Jahren Verdrängte, fast schon Vergessene. Man war dabei, sich einzurichten, nicht sich aufzurichten: gegen eine weiter existierende faschistische Geisteshaltung, gegen Antisemitismus – das Schicksal Mauthners im Film widerfährt dem Film selber.
So schreibt Karl Sabel in seiner Filmkritik „Der Ruf – Urteil oder Vorurteil?“ im Film-Echo vom 20. Juni 1949: „Ist Kortners Urteil nicht ein Vorurteil? Wogegen er auftritt, das, so glauben wir, lebt nicht mehr. […] Der Eindruck ist stark. Kortner fasziniert, selbst wo das Problem umstritten ist. Das bringt den Film über seine 104 Minuten. Nachher im Gespräch wird Widerspruch laut. In den Essener Zeitungen (nach der deutschen Erstaufführung in der Kleinen Lichtburg) wird Kortner ‚Ressentiment‘ vorgeworfen und beklagt, dass das ‚menschlich Verbindende, Allgemeingültige des Films‘ durch die ‚Primitivität des Gegenspielers verdunkelt‘ wird.“[4]
Kortners Film verfehlte seine Intention und Wirkung. Die Deutschen sahen lieber amerikanische Unterhaltungs- als „Erziehungs“-Filme. „Der Ruf“, einer der wenigen beeindruckenden Filme der westlichen Produktion in der Nachkriegszeit, ist das Werk eines Emigranten, seiner Sichtweise nach der Rückkehr in eine Heimat, die keine mehr war. Liest man die Berichte des Heimkehrers Adorno[5] und der „Besucherin“ Hannah Arendt[6], so findet man ähnliche Sichtweisen und Beurteilungen: Es ist der distanzierte Blick eines „Fremden“ auf das fremd gewordene Vertraute.
Kortners Film ist keineswegs eine haßerfüllte Abrechnung mit Deutschland. Er ist eine ehrliche, beklemmende Stellungnahme und Beurteilung, aufrüttelnd und mahnend. Der Film zeigt kein einziges Trümmerbild. Nicht eine Sekunde hat der Zuschauer die Möglichkeit, in Selbstmitleid zu fallen und das Geschehene zu beklagen. „Der Ruf“ zeigt die menschlichen Trümmer, die rigorose Zerstörung menschlicher und sozialer Beziehungen, Entwurzelung und Heimatlosigkeit Emigrierter, Vertriebener, Inhaftierter, Verfolgter; er zeigt das Fortleben des „alten Geistes“ in (Schulen und) Hochschulen und die strapazierte „Ausrede“ der ‚inneren Emigration ‚ – in differenzierter Abgrenzung zu einer glaubwürdigen inneren Emigration, wie es der Film am Beispiel des Präsidenten der Göttinger Universität aufzeigt.
„Es gab auch länger anhaltende Spannungen. Da blieb dann einer wegen irgendeines anderen von unseren Abenden eine Zeitlang weg. Solche Spannungen ergaben sich sogar zwischen Brecht und mir. Er beklagte einmal die Unfähigkeit der Deutschen zu revoltieren und nannte sie ‚knechtselig‘. Darüber gerieten wir aneinander. Ich war damals geradezu von einem exzessiven Enthusiasmus für das sogenannte andere, gute Deutschland erfaßt. Jahre später, nach meiner Rückkehr, lernte ich meinen Enthusiasmus zähmen.“[7]
Autorengruppe Nachkriegsspielfilme (1993)
[1] Völker, Klaus: Fritz Kortner. Schauspieler und Regisseur. Berlin 1987, S. 170.
[2] Kortner, Fritz: Aller Tage Abend. München 1929, S. 553.
[3] ebd., S. 538 u. 550.
[4] Karl Sabel, „Der Ruf – Urteil oder Vorurteil?“, in: Film-Echo, Nr. 18, 20. Juni 1949, S. 246.
[5] Theodor W. Adorno, Auferstehung der Kultur in Deutschland?, in: Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft, Frankfurt/M. 1980, 5.20 – 33.
[6] Hannah Arendt, Besuch in Deutschland, in: Zur Zeit. Politische Essays, Berlin/West 1986, S. 43 – 70.
[7] Fritz Kortner, Aller Tage Abend, S. 501.
Eine Liebe zu Deutschland
Bettina Greffrath (1993)
Von einer besonderen Art von Liebe und von heftigen und sich unmittelbar und spontan ausdrückenden Gefühlen der Wut, der Trauer, der Schwäche, der Enttäuschung erzählt dagegen DER RUF (Regie Josef von Baky, Urauff.: 19.4.1949). Die Handlung um die außergewöhnlich lebendig gezeichneten Figuren dieses Filmes ist fast durchgängig mit konventionellen Stimmungszeichnern in Szene gesetzt: Auch DER RUF bewegt sich zwischen Sonne und Schatten, reichem Glanz und schmutzig-bescheidener Finsternis.
Im sonnigen Kalifornien gesteht Professor Mauthner (Fritz Kortner) seine Liebe. Es ist noch eine doppelte: die ungelebte zu seiner jungen Assistentin Mary (Rosemary Murphy) und die verhinderte zu dem Land, aus dem man ihn fünfzehn Jahre zuvor, 1933, vertrieben hatte. Im Kreis der Freunde, deutschen Emigranten und Amerikanern, berät der Professor über den Ruf an die Universität von Göttingen. Mauthners Faktotum Emma (Lina Carstens) hofft voll verklärter Erinnerungen auf eine Rückkehr nach Deutschland. Nur Mary weiß, wie Mauthner sich entscheiden wird: Noch rede er, glaube, er höre nur auf seinen Verstand, berichtet sie Emma. Aber er werde zurückgehen und Mary kennt auf ihr Herz deutend – den Grund: „. . . er hat Sehnsucht“.
Die anderen Emigranten können Mauthner nicht verstehen. Dem kämpferischsten unter ihnen, Fränkl (Harald Mannl ) , antwortet der Professor auf die Frage, ob er vor diesen „Menschenfressern“ denn keinen Abscheu verspüre: „In meinen besten Momenten – nein.“ Und auf Fränkls Einwand, daß doch alle Deutschen mitgemacht oder zugeschaut hätten, schleudert er ihm wütend entgegen, er solle nicht von anderen verlangen, wozu er selbst nicht bereit sei, nämlich sein Leben zum Schutze anderer unschuldig Verfolgter zu riskieren. Dafür gebe es „noch allerlei Gelegenheiten auf der Welt.“ 77
Der Theaterregisseur und Schauspieler Fritz Kortner spielt die Rolle des Professor Mauthner. Er schrieb auch das Buch78 zu diesem außergewöhnlichen deutschen Nachkriegsspielfilm. 78
Der Film gestaltet deutlich erkennbar Erfahrungen und Einstellungen des Drehbuchautors, des Emigranten Fritz Kortner. Das Verhältnis Mauthners zum Deutschland der Nachkriegszeit ist getragen von Hoffnung und von der Rückerinnerung an positiv erlebte Traditionen; an das „andere Deutschland“. Im Film steht hierfür insbesondere die Dichtung Heinrich Heines, die Mauthner in Szenen zitiert, in denen er sich im physischen Sinne (auf dem Ozeandampfer, im Zug) auf Deutschland zubewegt. Der Wunsch des Emigranten, in das Nachkriegsdeutschland zurückzukehren, speiste sich vor allem aus Gefühlen für die Menschen und die Sprache seiner Heimat. 80
Die Eindringlichkeit, die wohl auch den zeitgenössischen Zuschauer dieses Films in Atem hielt, ihn verwirrte und berührte 81, ist m.E. vor allem auf diese „Leidenschaft“ für Deutschland zurückzuführen. Diese Liebe prägt aber auch das außergewöhnliche Menschenbild dieses Films. Die Personendarstellung unterscheidet sich deutlich von jener holzschnittartigen Statik, die für die Mehrzahl der untersuchten Spielfilme typisch ist. 82
Als Mauthner über die Grenze nach Deutschland fährt, zeigt sich, worin sich der Film von den meisten der „neuen“ deutschen Filme der Jahre 1945-1949 außerdem unterscheidet: Die Trümmer bleiben unsichtbar. Statt der larmoyanten Klage über das Elend im Nachkriegsdeutschland, ist im schwarzen Rechteck des Zugfensters das Gesicht eines Opfers der NS-Zeit zu sehen, eines Menschen, der voller Hoffnung und Liebe, aber auch mit klarem, an humanistischen Idealen orientiertem Blick dieses Deutschland und vor allem seine Menschen erlebt.
Dabei läßt DER RUF uns Zeit, lange in Gesichter zu sehen, Gespräche und Verständigungsversuche zu beobachten: zwischen Mauthner und seinen Kollegen und Freunden, zwischen der Amerikanerin Mary und dem nazistisch denkenden Walter, zwischen den jungen amerikanischen Assistenten des Professors und deutschen Altersgenossen in einem Tanzlokal, zwischen Mauthner und seiner geschiedenen Frau Lina.
Noch die kleinste Nuance in der Wahl der Sprache (deutsch oder englisch) oder der Worte, der Gestik und Mimik gewinnt hierbei Bedeutung, 1äßt Differenzen, Brüche und Widersprüche erahnen. Immer wieder wird spürbar, wie historisch-gesellschaftliche Erfahrungen die Haltungen der Menschen zu anderen bestimmen, verändern, beschädigen, wie lange Vorurteile und Traumatisierungen fortwirken. Mautner besucht Freunde, mit denen ihn sofort Herzlichkeit verbindet, er sucht seine geschiedene Frau Lina, der er zunächst in großer Vertrautheit begegnet. In ihrem langen Gespräch über das Vergangene zeigt sich, wie sehr Politik und Geschichte in die Empfindungen eingegangen sind, wie groß die persönlichen, erkennbar von Personen ausgehenden Verletzungen im jüdischen Emigranten Mauthner, wie unheilbar die intimsten Empfindungen für einen Menschen zerstört sind: Lina (Johanna Hoferl Kortners Ehefrau) hat ihren Mann, den ihr liebsten Menschen, aus Angst und „aus Feigheit“, wie sie selbst später über sich sagen wird, verraten und entwürdigt.
Eine große Bereitschaft zur Versöhnung bestimmt zunächst die Figur des Professors. B 3 Mit all seiner Kraft versucht Kortner, versucht die Filmerzählung den Figuren Gerechtigkeit widerfahren zu lassen: Mauthner hält Reden gegen den Kollektivschuld-Vorwurf, verzeiht den Freunden, die ihm aus eigener Not Informationen vorenthalten haben, sieht über kleine Gedankenlosigkeiten hinweg, wendet sich auch seiner Frau wieder zu, die sich aus „rassischen Gründen“ von ihm scheiden ließ. Diese Versöhnlichkeit schlägt erst viel später im Verlauf der Handlung in Verzweiflung und Resignation um.
„Tugend ist lehrbar“ – unter dieses Thema stellt Mauthner seine Antrittsvorlesung an der Universität. Wie zutreffend seine Analyse („Scham, Trotz und Mutlosigkeit verdunkeln euer Gemüt. „) und sein Rückblick (auf Antiintellektualismus und Irrationalität des Dritten Reiches) in seinem Vortrag 84 auch ausfallen, Zuspruch findet Mauthner nur von einzelnen Deutschen, von Menschen, die selbst zu Opfern in der NS-Zeit wurden oder ihnen beigestanden haben.85
Die Kollegen hatten mit seinem „Ruf“ eine große Hoffnung verbunden, die Hoffnung auf Mauthners Kraft, Köpfe und Herzen zu bewegen. Die Mehrzahl der Studenten beantworten Mauthners Appell an „höchste Einsicht, Mäßigung und tätige Nächstenliebe“ jedoch mit einer „Abstimmung mit den Füßen“, mit stummem Protest.
Der politisch „gewendete“ ehemalige Kollege Fechner (Paul Hoffmann) wird aus Konkurrenzneid sein Gegenspieler. Eher unabsichtlich entgleiten Fechner bei einer Willkommensfeier menschenverachtende und antisemitische Töne. Als Mauthner sich wiederum den handgreiflichen Argumenten der sogenannten „Stärkeren“ ausgesetzt und durch diese entwürdigt sieht, steigt auch in ihm langsam die Kälte hoch.
„Die Leute wollen Sie hier nicht“, sagt Hauswirtschafterin Emma am Ende des Films zum todkranken Professor Mauthner, um ihn zu einer raschen Rückkehr in das warme Kalifornien zu bewegen. Ihre Erfahrungen mit den Deutschen haben sie schnell frieren lassen. Diese Kälte spürte der Remigrant Mauthner solange nicht, wie seine Einstellung gegenüber Deutschland auf die Vorstellung baut: Tugend ist lehrbar, der Mensch wandlungsfähig. In seinem letzten Fiebertraum erinnert sich auch Mauthner an jene Kälte, die vor seiner Rückkehr nach Deutschland einer seiner deutschen Emigrantenfreunde vor dem lodernden Kamin empfunden hatte. Damals hatte einer seiner amerikanischen Assistenten an die Wochenschauen erinnert, in denen Schornsteine von Vernichtungslagern gezeigt wurden.
Kurz vor seinem Tod zeigt insbesondere die Darstellung von Fritz Kortner und Johanna Hofer den anderen Blick auf und das andere Ideal vom Menschen, der diesen Film deutlich aus der Untersuchungsgruppe heraushebt. Spontane Empfindungen des Professors wie Wut, Trauer und Verzweiflung, oder auch die Bereitschaft, eigene Fehler einzugestehen, werden noch in kleinen Gesten sichtbar. In einer kleinen Szene entschuldigt sich Mauthner bei seiner ehemaligen Frau für seine heftigen und verletzenden Vorwürfe. Zugleich wird durch seine Gesten die gefühlsmäßige Grenze des Erträglichen deutlich. Mauthner bleibt in einer freundlichen, sich schützenden Distanz. Ein sichtbar höheres Maß an Nähe und Vertrautheit kehrt zwischen Lina und ihm erst auf dem Totenbett zurück, als er sich und den Betrachter sowohl an heftige negative wie zugleich an ursprüngliche positiv-humane Gefühle erinnert:
(Lina kommt an das Totenbett Mauthners,)
Mauthner: Hoher Blutdruck: Mein verleumdetes Blut preßt und steigt (…) Das Blut unserer Jungen hat aber anderen Auslaß, es kocht und tobt und kämpft und fließt. Mir sprengt’s die alten Adern.
(Als Lina gehen will, bittet Mauthner sie, zu bleiben.
Mauthner: Alles, was ich brauche, ist Wärme, keinen Hass, und solche Augen. War’n die immer so?
(Er schaut Lina liebevoll an. Lina lächelt.)
(…) Schon im Fiebertraum sieht Mauthner seine Rückkehr nach Kalifornien szenisch vor sich, Im Traum erinnert er sich nicht an seine Erlebnisse in Deutschland. Wiederholt wird mit Kortners kräftiger Stimme aus dem Off der Satz, mit dem Mauthner die Angriffe Fränkls vor seiner Abreise nach Deutschland abgewehrt hatte: ‚Es gibt weder ein Volk von Verbrechern, noch ein Volk von Helden.‘)“
Mauthner: Die Sonne tut wohl.
Fränkl: Hier wirst du gesund.
Mauthner: Nein, ich kann nicht bleiben.
Fränkl: Wo willst du denn hin?
Mauthner, wie selbstverständlich: Heim.
(Überblendung von Mauthner auf das Sterbezimmer. Mauthner ist tot. Walter tröstet seine weinende Mutter – sanft streicht er ihr über den Rücken.) 86
Bei der abschließend gezeigten Beerdigung geht Walter neben seiner Mutter und der von ihm verehrten Mary. Er trägt eine schwarze Binde am Arm. Viele Studenten folgen dem Sarg. Bertram (Charles Regnier), Mitglied der nationalsozialistisch gesinnten Studentengruppe, reiht sich in den Trauerzug mit ein.
Auszug aus: Bettina Greffrath: Verzweifelte Blicke, ratlose Suche, erstarrte Gefühle, Bewegungen im Kreis. Spielfilme als Quellen für kollektive Selbst- und Gesellschaftsbilder in Deutschland 1945-1949. Diss. Universität Hannover 1993, S.
Der Film entstand im Atelier München-Geiselgasteig mit Außenaufnahmen aus München und Umgebung
In Fritz Kortners Erinnerung mischen sich im Rückblick 1959 die Schwierigkeiten der Produktionsbedingungen mit den Ängsten des Rückkehrers:
„Über die Luftbrücke versahen die Alliierten die Westberliner mit dem unerlässlich Notwendigen. Es blieb alles knapp bemessen. So gab es nicht genug Elektrizität, um unseren Film […] in Berlin zu drehen. Wir mussten nach München fliegen. Der Gedanke, in München auch nur ein paar Wochen zu leben, flößte mir tiefes Unbehagen ein.“
„The courage to think“
Bettina Greffrath (1993)
Nur wenige Filme propagieren wie UND WIEDER 48 den unverstellten Gebrauch des eigenen Verstandes. Kein Film tut dies so deutlich wie der in der amerikanischen Zone entstandene Spielfilm DER RUF (Urauff. 79.4.1949). Da der Film bereits in einem anderen Zusammenhang untersucht wurde, fasse ich hier zur Erinnerung den Inhalt nur kurz zusammen:
Ein jüdischer Emigrant, deutscher Philosophieprofessor in Kalifornien, kehrt auf einen Ruf seiner alten Universität in Göttingen in das Nachkriegsdeutschland zurück. Wieder schlagen ihm und seiner Lehre Vorurteile, Revanchismus und Antisemitismus entgegen. Seine großen Hoffnungen auf Deutschland werden enttäuscht. Der Professor stirbt, noch bevor er wieder in seine sonnige Wahlheimat zurückkehren kann. Er erlebt auch nicht mehr, daß einige der Studenten durch seine aufrechte Haltung nachdenklich geworden sind.
Besonders in seinen Ansprachen, die das Buch von Fritz Kortner dem Protagonisten Professor Mauthner im Film DER RUF in den Mund legt, wird das Credo dieses außergewöhnlichen Nachkriegsspielfilmes deutlich. Allerdings brechen sich in diesem Film, seiner düsteren Atmosphäre und seinem nur wenig Hoffnung verheißenden Ende m.E. bereits Erfahrungen des Remigranten Kortner im Nachkriegsdeutschland.
In der „Film-Synopsis“ „THE MISSION“, überliefert in den Omgus-Akten70 und handschriftlich datiert vom 26.1.1948, ist der im Wortsinn tödliche Ausgang der Erlebnisse des Professors (Figurenname hier noch ‚Paul Beck‘, im Film: Mauthner‘ ) im Nachkriegsdeutschland noch nicht entworfen.
Außerdem enthält dieser Entwurf noch andere signifikante Abweichungen gegenüber dem realisierten Film. Hier ist es die junge amerikanische Assistentin, die den Professor erst von der Bedeutung seiner Rückkehr nach Deutschland überzeugen muß:
„Cynthia, however, is so deeply affected by the nature of the appeal that she finaily convinces him it is his duty to go back. „71
Im realisierten Film ist der Professor selbst von starker Sehnsucht nach Deutschland, seiner Sprache und Kultur und, wenn auch nicht so deutlich, wohl auch von der Hoffnung getrieben, zu einer Wandlung der Deutschen beitragen zu können.
Der Entwurf nennt – außer dem ihm entgegenschlagenden Antisemitismus – noch andere Momente, die ihn an seiner Entscheidung, nach Deutschland zurückzukehren, zweifeln lassen:
„As professor Beck arrives in Germany and sees the terrific physical destruction, as he begins to realize the tremendous obstacles in reconstruction, particularly for an educator, he wonders if he has made a mistake in leaving behind his comfortable home and position in America (…).“ 72
Gerade das Problem der materiellen Zerstörung Deutschlands spielt im realisierten Film eine völlig untergeordnete Rolle.
Auch sind in DER RUF in Professor Mauthners Wunsch zur Rückkehr nach Californien keinerlei materielle Motive erkennbar. In der „Synopsis“ war wiederum vorgesehen, daß die jungen Amerikaner ihm helfen, seinen Glauben zu behalten, das Richtige getan zu haben. Die Beschreibung der Aufnahme des Professors in Göttingen durch die Studenten fällt im Vergleich zur späteren Darstellung im Film ausgesprochen optimistisch aus: „(…) his lectures soon become very popular with the students : 73
Die Antrittsrede Mauthners, die im fertigen Film DER RUF inszenatorisch betont die Wende zum skeptisch-düsteren Schluß einleitet, möchte ich – auch weil die Worte im Zuge der Entwicklungen unserer Zeit m.E. eine erneute Aktualität gewonnen haben aus meinem Filmprotokoll wiedergeben. Sie hat in der Atmosphäre nichts von jenen gefühllos-hölzernen Ansprachen, wie sie in vielen Filmen des Untersuchungszeitraumes als Verlautbarungen des guten Willens und im DEFA-Film als Propagierung neuer Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle enthalten sind. Mauthners Rede zeigt das „Herzblut“ des Sprechers, eine Authentizität in den Empfindungen, wie sie sonst allenfalls in Ausnahmefiguren 74 spürbar ist. Rationalität und Gefühl vereinen sich mit moralischen Postulaten und einer kämpferischen und parteilichen Haltung. Die Worte verbinden sich mit einer Liebe und einer Hoffnung, die sich am Ende des Films in Ohnmacht verkehrt:
“ (Mauthner steht in einem alten Hörsaal der Universität Göttingen. Er beginnt seine Antrittsvorlesung in deutscher Sprache mit den Worten:)
Am 12. Januar 1933 – hier an dieser Stelle sprach ich über Platons Konzept von der Erlernbarkeit der Tugend.
(Mauthner wechselt anschließend ins Englische, wiedergegeben sind jeweils die deutschen Untertitel:)
Ich erkannte die Verneinung des Guten und warnte vor der Verschwörung gegen Intellekt und Geist. Ihr (in englischen Text: My friends), die Erben dieser Zeit, dürft nicht tatenlos zusehen, wie eine neue Epoche anbricht. Das Problem des Hungers wird nicht auf dem Schlachtfeld gelöst sondern nur durch unser Denken. Im klaren menschlichen Denken zeigt sich das Göttliche. Ergreifen Sie Partei. Erst wenn der Philosoph König der Könige geworden ist und die Mächtigen philosophisch denken, – erst wenn Weisheit und Staatskunst – in ein und derselben Person verkörpert sind, erst dann ist ein Staat vom Übel befreit. Was Platon vor über 2000 Jahren sagte, ist das Gebot der Stunde.
(Kamera-Ranfahrt)
Doch werden unsere Mächtigen jemals Philosophen? Ich bin pessimistisch. (Die Kamera steht jetzt hinter Mauthner. Einige Studenten lachen. Mauthner dreht sich nach ihnen um und lacht mit. ) Deshalb müssen Wissenschaft und Weisheit an ihre Stelle treten. Der Wissenschaftler (betont) muß kämpfen, damit sein Wissen anerkannt wird. Das bedeutet keine Einschränkung seiner Freiheit.
Erst höchste Einsicht, Mäßigung und tätige Nächstenliebe berechtigen euch, Freiheit für euch zu fordern. In einer angemaßten Freiheit wird falsches Denken ermutigt, bis es zur Katastrophe führt. Falsches Denken führt zu falschen Göttern (…). Die falschen Lehren der letzten 12 Jahre hätten sich nie verbreiten und euer Leben bestimmen dürfen. (. . .) 1933 wurde die Vernunft durch Aberglauben ersetzt. Doch jede Absage an die Vernunft führt zu Unvernunft. (Schwenk zu Fechner im Auditorium, der sich nach den anderen Hörern umsieht‘ einzelne Studenten räuspern sich, einer steht auf.) Diese Jahre wurden durch irrationale Impulse bestimmt: (…) Jetzt seht ihr die Folgen den völligen Zusammenbruch. Scham, Trotz und Mutlosigkeit verdunkeln euer Gemüt. (Mauthner von vorn aus der leichten Obersicht; Kamerawegfahrt.) Dunkle Nacht senkte sich über Deutschland. Ihr seht diese Nacht als neuen Tag. Ihr verwechseltet Licht mit Dunkelheit Schwarz mit Weiß, Tat mit Untat. Jetzt wollen viele unter euch die Augen nicht öffnen. Ihr nennt den neuen Morgen Dunkelheit.
(Kamera fährt nun immer weiter weg. Totale erfaßt Mauthner aus der Obersicht. Sichtbar wird das Licht, das oben in den Saal dringt. Der Professor spricht mit freundlicher, weicher Stimme:)
Doch dieser Morgen kann Tag werden, öffnet euch ihm. Erkennt den Sinn der Schöpfung. Ihr seid jung. Eines Tages werdet ihr erkennen: Manche verlorene Schlacht gibt mehr Anlaß zu Triumph – als der Sieg.“7s
Im Film bleiben die Studentenreaktionen im Vergleich zum Treatment in einer indifferenten Schwebe: Zwar können sich viele der Zuhörer der Faszination der Person und des Gedankenflusses nicht entziehen – geplante Störaktionen unterbleiben -, doch nur eine sehr kleine Minderheit äußert ihre Zustimmung zu Prof. Mauthners Ausführungen. Unter ihnen ist eine junge Frau, die sich später als Opfer des NS-Regimes zu erkennen gibt, mit ihrem Freund. Zu ihnen dreht sich Mauthner in einer bescheiden-dankbaren Geste noch einmal um, bevor er den Hörsaal verläßt, von der lautlosen „Abstimmung mit den Füßen“ gegen ihn scheinbar unberührt.
Die kollektive Ablehnung, die auch der jüdische Remigrant Fritz Kortner vielfach in Deutschland erfuhr76, könnte die genannten Verlagerungen und emotionalen Zuspitzungen in der Darstellung der Handlungsmotive erklären. Die vergleichsweise hoffnungsvolle Tendenz des ersten Entwurfes zu DER RUF findet sich auch in einer ISD/MPB OMGUS-Akte mit dem Titel „German education“77, die ein Treatment aus dem Februar 1948 von Kortner für einen Dokumentarfilm enthält. Dieser sollte die Unterwerfung des (universitären) Geistes in Deutschland unter die marschierenden Stiefel des nationalsozialistischen Regimes zeigen. Ebenfalls am Beispiel eines Professors und seiner Worte wird in diesem Entwurf die Notwendigkeit des rationalen Denkens und der aufrichtigen Suche nach Wahrheit beschworen:
„…Nothing can happen to Germany as long as its people are not afraid to think an honestly search for the truth. True thought and real truth must be aim for every man. It may be easy to find a philosophy (undeutlich, 8.G.,: ) custom-built from party programs or a political outlook snatched from the newspaper headlines. To think is harderi to think — and to stand by the ideas which thinking provokes reguires courage. It is this courage to think for yourself that must now be instilled in germany…“ 78
Was Kortner seiner akademischen Figur hier in den Mund legt, ist die Hoffnung auf die Fähigkeit der Deutschen, zu einem eigenständigen, tabulosen, im Wortsinn radikalen Denken und einem im Sinne dieses Denkens konsequenten Handeln zu finden.
Mut würde zu einer solchen Haltung und einem dieser entsprechenden Verhalten gehören, das wußte Kortner, ein Mut, den der unbequeme Theaterregisseur und Schauspieler nach seiner Rückkehr immer wieder bewiesen hat.79 Laut Treatment sollte diese Mahnung angesichts der Ruinen des Nachkriegsdeutschland fortgesetzt werden:
„…as I was saying, look for the truthr no matter, what party you belong, no matter, what political faith you may embrace. The chances to think, the freedom of free ideas is ours again……“ 80
Im Mittelpunkt des Dargestellten sollte es um junge Männer und Frauen gehen, die dort wiederanfangen sollten, wo Deutschland 1933 aufgehört hatte:
„Living together, building together, studying together, they are finding that free university – uncrippled by party dogma and partisan control – is the national Kindergarten from which young people again will go forth with the courage to think.“ 81
Kortners Hoffnung auf die Fähigkeit der jungen Deutschen, mit Wahrheitsliebe, Auseinandersetzungsfähigkeit und Toleranz eine humane und demokratische Gesellschaft aufbauen zu helfen, war im amerikanischen Exil gewachsen und führte dort bereits immer wieder zu Streitigkeiten über Deutschland und die Deutschen. 82 1959 schreibt Kortner in Erinnerung an seine Entscheidung, nach Deutschland zurückzukehren:
„Meine (im Gegensatz zu vielen Emigrantenfreunden, B.G. ) anders geartete Einstellung zu Deutschland beruhte, von meinem Wunschtraum abgesehen, auf der Erkenntnis, daß jedes Volk unter gewissen sozialen und historisch bestimmten Umständen gleichfalls so entarten könne und ähnlich bestialisch handeln würde. (…) Ich war und bin überzeugt davon, daß es keine deutsche Kollektivschuld gibt, jedoch eine Kollektivschuld der machthabenden Kreise in Deutschland, England, Frankreich und Amerika durch die fast komplicenhafte Duldung des hitlerischen Aufstiegs, seiner Machtergreifung und seiner Raubzüge.“ 83
„(…) Ich rüstete mich zur Reise. Die Emigranten standen kopf. Ich verkrachte mich noch schnell mit manchen der unversöhnlichen Hasser.
Sie fanden dann später den Weg ins deutsche Wirtschaftswunderland und kamen besser damit zurecht als ich, der ich mit so viel Erwartung gekommen war.“ 84
Kortners eigene Hoffnung, die er dem Protagonisten von DER RUF in den Mund legt, die, daß „Tugend“ „lehrbar“ sei, wurde in Deutschland rasch enttäuscht. Vorurteile, die ihm etwa der Rezensent Karl Sabel zuschreibt 85, schlugen Kortner selbst auf das heftigste entgegen. Diese Erlebnisse hatten die – auch nicht bruchlos resignative – Tendenz in DER RUF vorbereitet. 86
Kortner wurde z.B. massiv unterstellt, daß er nach Deutschland nur zurückgekommen sei, um hier viel Geld zu verdienen: Ein Vorwurf, der sich übrigens in der hämisch-antisemitischen Haltung Fechners und Anspielungen auf die „typisch jüdische“ „merkantile Seele“ Mauthners wiederfinden läßt. Entsprechend dieser Erfahrung hatte sich die Ausrichtung der Filmgeschichte möglicherweise schon im Mai des Jahres 1948 verlagert.
Kortner selbst faßte zu diesem Zeitpunkt den Inhalt des nach eigenen Angaben 200 Seiten umfassenden Drehbuches folgendermaßen zusammen:
„‚Der Ruf‘ schildert die Heimkehr eines Professors der Philosophie, der aufgefordert wurde, seine Tätigkeit in Deutschland wieder aufzunehmen. Er spürt nun an Ort und Stelle der Vergangenheit nach und bei der Konfrontation mit ihr zeichnen sich bereits die Gefahren und Hoffnungen der Zukunft ab, wobei – meiner Einstellung entsprechend – die Betonung auf dem Wort ‚Gefahren‘ liegt. Ein Stoff also hautnah unserer Zeit.“ 87
Der Kritiker Karl Sabel setzt gegen Kortners Analyse im Spielfilm DER RUF ein Glaubensbekenntnis:
„Kortner selbst bleibt skeptisch, so heiter-ernst und sehnsüchtigen Herzens er seinen guten Gedanken hegte: uns über uns selbst hinwegzuhelfen und ein Ziel in einer edleren geistigen Heimat zu zeigen. Doch er läßt seine Idee nicht triumphieren. Er hält die Mächte des Ungeistes noch für stärker. Nur um einige wenige Junge legt er das Morgenrot der Hoffnung.
Ist Kortners Urteil nicht ein Vorurteil? Wogegen er auftritt, das, so glauben wir, lebt nicht mehr.“ 88
Sabel beklagt schließlich ein Dilemma, in dem Kortner sich trotz bester Motive s. E. befinde:
„(…) sich zu mühen, objektiv zu sein und doch ungerecht zu bleiben und darum auch das bessere Menschliche nicht zu finden, das er unter Seelenschutt hervor holen möchte.“ 89
Sabels Beschreibung des Films, die sich fast ausschließlich auf die Wirkung Kortners in seiner Rolle bezieht, bleibt insgesamt in jener Ambivalenz, mit der die Besprechung ausklingt:
„Der Eindruck ist stark. Kortner fasziniert, selbst wo das Problem umstritten ist. Das bringt den Film über seine 104 Minuten. Nachher im Gespräch wird Widerspruch laut. In den Essener Zeitungen (nach der westdeutschen Erstaufführung in der Kleinen Lichtburg) wird Kortner ‚Ressentiment‘ vorgeworfen und beklagt, daß das ‚menschlich Verbindende, Allgemeingültige des Films‘ durch die ‚Primitivität des Gegenspielers verdunkelt‘ wird. Doch neben der Kritik meldet sich Respekt vor einem suggestiven Film. Und ebenso, abwehrend und doch hingegeben, antwortet auch das Publikum.“ 90
Der Vorwurf des Vorurteils und des Mangels an Objektivität, der einer so persönlich und auch emotional reagierenden Person allzu leicht angehängt werden konnte, kehrt in verschiedenen Kritiken zu DER RUF wieder. 91 Doch alle mir bekannten Rezensionen unterstellen Kortner zumindest ein positives Anliegen. Die Beurteilungen des im Film DER RUF dargestellten Problems der Wiederkehr des Antisemitismus im Nachkriegsdeutschland offenbaren Unsicherheit ebenso wie Wunschdenken und Verleugnung.
„In nackten Worten: es ist die Sorge um das Wiederaufleben des Rassenhasses in Deutschland. Wir wissen nicht, ob Kortner mit dieser Befürchtung recht hat. Ein Gezeichneter, der zugleich ein Liebender ist, sieht vielleicht schärfer als wir. Wir wissen nur, daß er nicht recht behalten darf.“ 92
Über die Publikumsreaktionen läßt sich den Rezensionen ebenso Zwiespältiges entnehmen. Erschrecken und Faszination angesichts der Heftigkeit der Gefühlsäußerungen Kortners zeigt sich z. B. in der folgenden Kritik:
„Obwohl die des Nachdenkenswerte ‚Heimkehr‘ des Professors Mauthner mit zorniger Liebe erzählt ist und die Schatten kräftig zu setzen weiß, traf der Film bei seiner Hamburger Erstaufführung (… ) auf sichtlich bewegte Herzen. “ 93
Das (scheiternde) Verhaltensmodell Professor Mauthners ist durch folgende Merkmale bestimmt:
- die Weigerung, vorhandene Widersprüche zuzudecken,
- die Fähigkeit, über reale Verluste zu trauern, ohne sie ständig selbstmitleidig zu beklagen,
- die Fähigkeit, eigenes Fehlverhalten zu sehen, zu begreifen und zu korrigieren. 94
Im Jahr der Erstaufführung verhallte DER RUF trotz überwiegend positiver Kritiken sehr rasch.95 Ende 1949 kommentierte dies die Zeitschrift Film-Express mit unverhohlen bissig-kritischem Unterton so:
„Dem Film blieb bisher wegen der konstruierten Handlung ein größerer Erfolg versagt, trotz der großartigen Darstellung im alten Kortner-Stil. Das trieb den großen Schauspieler zu der abwegigen Ansicht, daß das deutsche Volk, weil es seinen aus zornigem Herzen geschriebenen und gespielten Film ‚Der Ruf‘ weniger mag, noch immer vollkommen antisemitisch verseucht sei.“ 96
Schon 1949 begann für Fritz Kortner eine Kette von Auseinandersetzungen um seine provokativen Theater- und später Fernsehinszenierungen. In ihnen offenbarte sich immer wieder, „wie tief der Riß denn doch war zwischen dem Emigranten, den die Nazis zum jüdischen Dämon schlechthin erklärt hatten, und den daheimgebliebenen braven Untertanen, die schlechten Gewissens sich in die Rolle von Opfern der Rachsucht dieses Dämons gedrängt sahen.“ 97
„The courage to think“ – den Mut, radikal und auch Widersprüche aushaltend zu denken und auf das Wahrgenommene und Durchdachte auch mit dem Gefühl zu reagieren, dieses „Herz und Hand“ vereinigte Kortner in seinem Protagonisten und in seiner eigenen Haltung als Künstler im Nachkriegsdeutschland.
Diese Verbindung ist in den Filmfiguren der untersuchten Filme eine deutliche Ausnahme. 98
Auszug aus:
Bettina Greffrath: Verzweifelte Blicke, ratlos Suche, erstarrende Gefühle, Bewegungen im Kreis. Spielfilme als Quellen für kollektive Selbst- und Gesellschaftsbilder in Deutschland 1945 – 1949. Diss Universität Hannover 1993, S. 513-522
Zur Einführung:
Diese Filmdichtung aus unseren Tagen erzählt uns die dramatischbewegte Geschichte eines Universitätsprofessors, der nach Übersee auswanderte.
Nach fünfzehnjährigem Exil in Kalifornien, wo er eine neue Wirkungsstätte gefunden hat und sich zum erfolgreichen Pädagogen der jungen amerikanischen Generation eingearbeitet hat, erhält Professor Mauthner eine ehrenvolle Rückberufung in seine Heimat, nach Deutschland.
Freunde raten ihm ab, diesem Ruf Folge zu leisten; ältere Kollegen beneiden ihn um diesen neuen Lehrauftrag.
Mauthner, der beim Abschied von seinen Freunden und Schülern der Neuen Welt ein warmherziges Bekenntnis zu Deutschland ablegt und auf die Frage eines Kollegen, ob er dieses Land trotz aller schmerzlichen Erinnerungen liebe, unbedingt antwortet: „In meinen besten Augenblicken – ja!“, folgt der Stimme seines Herzens und seiner geheimen Sehnsucht und kehrt ohne einen noch so verlockenden Zwischenaufenthalt in Paris direkt nach Deutschland zurück.
Berlin und andere Universitätsstädte sind die Stationen seiner ereignisreichen wie schicksalsschweren Rückkehr. Mauthner erlebt die Nachkriegszeit des Berlin von 1948. Er sucht und findet seine geschiedene und aus den Augen verlorene Frau wieder, erfährt von ihr, daß angeblich sein Sohgn, den er einst als Bub zurückgelassen, noch in Kriegsgefangenschaft ist.
Seine Vorlesung an der Universität nimmt Professor Mauthner mit dem gleichen Thema auf, mit dem er vor einer halben Generation seine Dozententätigkeit unfreiwillig hatte beenden müssen, und siehe: an der Wahrheit des Geistes hat sich nichts geändert. Mauthner bringt seinen kritischen Studenten Platos Vermächtnis über den Grundbegriff der Tugend nahe.
Doch persönlicher Neid eines ebenso ehrgeizigen wie politisch fragwürdigen Kollegen, des Dozenten Fechner, und die politische Einstellung einiger Vertreter der akademischen Nachkriegsjugend erschütternMauthners Glauben an seine Aufgabe.
Mauthner hätte es sich bei seiner Rükkehr nach Deutschland gewiß nicht träumen lassen, daß unter den Studenten der Opposition sich auch sein eigener, inzwischen heimgekehrter Sohn befindet. Ebensowenigdachte er daran, daß man ihm, dem gealterten Manne, seine rein freundschaftliche n und wissenschaftlich verankerten Beziehungen zu der Studentin MAry, zugleich seine Sekretärin, die er aus Kalifornien mit zwei weiteren Assistenten und einer Hausangestellten mitbrachte, zweideutig auslegen würde.
Die Schlußszenen dieses dramatischen Films bringen die Auflösung der Wirren eines verzweifelten Lebens, das ein tragisches Opfer unseres unruhevollen Zeitgeistes wurde, in letzter und unvergeßlicher Eindringlichkeit.
Dr. K. W.
aus: Illustrierte Film-Bühne Nr. 347
Umstrittener Kortner-Film ?
Dass vier Jahre nach Kriegsende Filme, in denen die Verbrechen während der NS-Zeit und der Mord an den Juden berührt wurden, beim westdeutschen Kinopublikum kaum auf Resonanz stießen, zeigte sich auch an dem unter der künstlerischen Oberleitung von Fritz Kortner produzierten Film »Der Ruf«. Kortner, 1947 aus der Emigration zurückgekommen, spielt darin einen jüdischen Professor, der nach seiner Rückkehr aus dem Exil an den in Deutschland weiterwirkenden antisemitischen Denk- und Verhaltensweisen zugrunde geht.
Dieses „Scheitern müssen“ deutet sich auch ein den Filmkritiken an, wenn z.B. K. Sabel sich selbst die Frage stellt, ob nicht kortners Urteil ein Vorurteil sei und diese dann auch gleich beantwortet: „Wogegen er auftritt, das, so glauben wir, lebt nicht mehr.“! Der Spiegel setzt dagegen „Kortner hat während der kurzen Zeit seines bisherigen Aufenthalts in Deutschland sehr genau zugesehen und zugehört.“ Diese Hinsehen beurteilt Herrmann weniger eindeutig: „Was er hier sah, oder zu sehen glaubte – als Jude -, hat er in dem Film „Der Ruf“ auszusprechen versucht. In nackten Worten: es ist die Sorge um das Wiederaufleben des Rassenhasses in Deutschland. Wir wissen nicht, ob Kortner mit dieser Befürchtung recht hat.“ Für den Autor des Weser Kuriers ist der Sachverhalt klarer: „Dass der Versuch nicht gelang – oder doch nur teilweise gelang – mag an den bitteren persönlichen Erfahrungen liegen, die Kortner nach seiner Rückkehr machen mußte. In seinem Film befindet sich der immer spürbare Wunsch nach Toleranz im fortwährenden Widerstreit mit einem bedenklichen Mangel an Objektivität.“
Siehe zur Rezeption des Films auch hier „Zur Vorgeschichte und Rezeption des Films“
Ich erwarte Protest!“ sagte Fritz Kortner während der Dreharbeit zu seinem Film „Der Ruf“. Die Uraufführung im Berliner Marmorhaus erfüllte die Erwartung Kortners noch nicht.
Fritz Kortner, der Franz Moor und Mortimer, Macbeth und Marquis von Keith aus der großen Zeit des Berliner Theaters unter Reinhard und Jessner, kehrte im Dezember 1947 aus der kalifornischen Emigration nach Deutschland zurück. Ohne jeden Auftrag der Besatzungsmacht, als Privatmann also und als deutscher Schauspieler. (…)
Urteil oder Vorurteil?
Platos Ideal des freien Geistes: nach der Wahrheit zu leben, Unduldsamkeit und Haß zu verabscheuen, ist Kortners „Ruf“ an die Deutschen. Was er darüber der Jugend vom Katheder sagt, hat eine Sprache von solcher Hoheit und Klarheit des Geistes, wie sie in einem Film nicht häufig zu finden ist, und der Gedanke wird von diesem außerordentlichen Darsteller so beschwörend vorgetragen, dass auch die ihn hören, die ihm widersprechen
Ein sehr subjektiver Film. Kortners eigenes Schicksal ist von ihm notiert. Auch er war jüdischer Emigrant wie sein Professor Mauthner; er selbst schrieb das Drehbuch und spielte auch die Hauptfigur. Ankläger und Zeuge in eigener Sache. Dies dreifache Zusammenklingen von gedichtetem und echtem Erlebnis macht den Film zur persönlichen Aussage. Hier hat es denn auch der Einwand gegen die Objektivität der Beschreibung leicht.
Kortner selbst bleibt skeptisch, so heiter-ernst und sehnsüchtigen Herzens er seinen guten Gedanken hegte: uns über uns selbst hinwegzuhelfen und ein Ziel in einer edleren geistigen Heimat zu zeigen. Doch er läßt seine Idee nicht triumphieren. Er hält die Mächte des Ungeistes noch für stärker. Nur um einige wenige Junge legt er das Morgenrot einer Hoffnung.
Ist Kortners Urteil nicht ein Vorurteil? Wogegen er auftritt, das, so glauben wir, lebt nicht mehr.
Ein solcher Phrasenheld von neofaschistischem Professor, wie ihn Kortner als Gegenspieler sich erfindet, ist kein Partner für eine Auseinandersetzung, sondern nur eine komische Figur. Gefährlich wäre er, wenn er nur eine Spur des Dämons verriete, der das beschwor, was Kortner meinte. Da Kortner sein Florett gegen ein Schemen richtet, ficht er mit dem Wind. Auch die schreckliche Simplifizierung der lärmenden Studenten stimmt mit dem Geist und der Vernunft nicht überein, die Kortner anfänglich aufbietet. So erschüttert uns mehr als ein Zusammenprall zweier Weltanschauungen der Zwiespalt in der Brust des Heimkehrers Kortner: sich zu mühen, objektiv zu sein, und doch ungerecht zu bleiben und darum auch das bessere Menschliche nicht zu finden, das er unter Seelenschutt hervorholen möchte.
Ja – ein Vorurteil hemmt ihn. Erst wo der Zwiespalt in der vertrautesten menschlichen Nähe sich löst – in der Begegnung mit der arischen Frau -, kommt es zum guten Ende, weil hier nicht nur Vernunft und Geist angerufen werden, sondern einfach die Liebe.
Dennoch ist der „Ruf“ unüberhörbar und sollte gehört werden. Seine Sprache ist eindringlich, sonderlich durch Kortner selbst. Ein Antlitz, in kühn geschnittenen Großaufnahmen zu einer wahren Landschaft geweitet, von lauten und leisen, lächelnden und verzweifelten Zeichen überronnen, wie Licht und Schatten über einer Ebene. Dies Antlitz drängt vor und greift förmlich nach den Betrachtern, sie zu überwältigen. Nur wenige Gesichter unter uns haben eine solche Gewalt des optischen Ausdrucks.
Josef von Baky und sein Kameramann Werner Krien formten es mit Spürsinn für seine filmische Wirksamkeit in verdichtenden Bildern. Erschütternd das Duldende in Johanna Hofers leidvoll-mütterlichem Antlitz. Virtuos gespielte Hohlheit des Professors (Paul Hofmann). Die JUgend: AMerikas Rosemary Murphy, unbefangene Lebensfreude eines glücklichen Landes vertretend, und Ernst Schröder, der deutsche Landsknecht, dem Zwiespalt das Schicksal seines Volkes ist, als Student; Apmann, kalt, zynisch.
Der Eindruck ist stark. Kortner fasziniert, selbst wo das Problem umstritten ist. Das bringt den Film über seine 104 Minuten. Nachher im Gespräch wird Widerspruch laut. In den Essener Zeitungen (nach der westdeutschen Erstaufführung in der Kleinen Lichtburg) wird Kortner „Ressentiment“ vorgeworfen und beklagt, dass das „menschlich Verbindende, Allgemeingültige des Films“ durch die „Primitivität des Gegenspielers verdunkelt“ wird. Doch neben der Kritik meldet sich Respekt vor einem suggestiven Film. Und ebenso, abwehrend und doch hingegeben, antwortet auch das Publikum.
Karl Sabel: „Der Ruf“ – Urteil oder Vorurteil? In: Film-Echo, Nr. 18, 20.06.1949, S. 246.
Fritz Kortner stand noch im Februar 1933 als Shylock auf einer Hamburger Bühne. Zwölf Jahre vorher gehörte er mit Erich Ziegel und Gustaf Gründgens zu den Begründern des Ruhmes der ersten Hamburger Kammerspiele. Seine Bühnen- und Filmrollen – darunter „Dreyfuß“ – sind seither unvergessen. Der große Schauspieler hat mit Thomas Mann nicht nur das Schicksal des Ausgestoßenen und Emigranten gemeinsam, sondern auch das, was der Dichter die „Heimat In der deutschen Sprache“ nannte. Die Liebe zu dieser Heimat war stärker als die erfahrene Unbill. Sie rief Kortner schon 1948 nach Deutschland zurück. Was er hier sah, oder zu sehen glaubte – als Jude -, hat er in dem Film „Der Ruf“ auszusprechen versucht. In nackten Worten: es ist die Sorge um das Wiederaufleben des Rassenhasses in Deutschland. Wir wissen nicht, ob Kortner mit dieser Befürchtung recht hat. Ein Gezeichneter, der zugleich ein Liebender ist, sieht vielleicht schärfer als wir. Wir wissen nur, dass er nicht recht behalten darf. So mag denn dieser künstlerisch übrigens interessante, wenn auch nicht durchweg überzeugende Film als ein vorbeugendes Prophylaktikum willkommen geheißen worden. Obwohl die des Nachdenkens werte „Heimkehr“ des Professors Mauthner mit zorniger Liebe erzählt und die Schatten kräftig zu setzen weiß, traf der Film bei seiner Hamburger Erstaufführung in der „Urania“ auf sichtlich bewegte Herzen. […]
W. M. Herrmann: Erstaufführung: „Der Ruf“. In: Hamburger Allgemeine, 26.8.1949.
[…] Die Tatsache, dass Fritz Kortner seinen Film nicht in Amerika, sondern in Deutschland drehte, spricht für ihn und die Lauterkeit seiner Motive. Wenn er nämlich den Versuch unternahm, den Antisemitismus und die aus ihm resultierende Vergiftung der geistigen und politischen Atmosphäre vom Standpunkt des Betroffenen aus zu beleuchten, so konnte dies nur dort geschehen, wo das Problem heute noch auf den Nägeln brennt. Dass der Versuch nicht gelang – oder doch nur teilweise gelang – mag an den bitteren persönlichen Erfahrungen liegen, die Kortner nach seiner Rückkehr machen mußte. In seinem Film befindet sich der immer spürbare Wunsch nach Toleranz im fortwährenden Widerstreit mit einem bedenklichen Mangel an Objektivität.
„Der Ruf“ ist ein Film der halben Wahrheiten. Seine Fakten sind unumstößlich: die schmachvolle Austreibung bedeutender jüdischer Gelehrter, ihre Wiederberufung an deutsche Universitäten, das auch heute noch akute Vorhandensein antisemitischer Strömungen. Nur das Bild, das der Film zeigt, ist schief. Er setzt voraus, dass die Mehrzahl der deutschen Nachkriegsstudenten aus nazistisch verseuchten, notgedrungen in Zivil herumlaufenden Rüpeln besteht, während die anständige Minderheit zwar vorhanden, aber unentschlossen, wenn nicht feige ist. Er konzentriert in der Figur des charakterlosen, heimtückischen und korrupten Dozenten einen Gegenspieler des heimgekehrten Philosophenprofessors, der in der Wirklichkeit des heutigen akademischen Lebens auch nicht die Spur einer Chance hätte. Unter der Führung dieses Subjekts lassen sich die Studenten zu Exzessen hinreißen, die die Haushälterin des Professors zu dem leichtfertigen Ausspruch veranlassen: „Es sind doch Menschenfresser!‘, und den Rektor der Universität zu dem Rat: Fahren Sie wieder nach Amerika. Am liebsten käme ich mit Ihnen.‘
Hier liegt der psychologische Fehler des Drehbuches von Kortner. Es ist überschattet von einer verhängnisvollen Resignation. Die geistige Not unserer um die Wahrheit ringenden akademischen Jugend wird bagatellisiert, ihre tatsächlichen Probleme werden an die Peripherie der Handlung verwiesen. Kortners Anliegen ist ein ehrliches und warmherziges; sein Film ist ein Irrtum.
Josef v. Bakys Regie bemühte sich, die thematischen Unebenheiten zu glatten, den Subjektivismus der Handlung durch die eindeutige künstlerische Leistung in Fotografie und Darstellung auszugleichen. Aber auch ihr konnte es nicht gelingen, den betrüblichen Eindruck des Vorurteils, den der Film hinterläßt, vergessen zu machen.
Was bleibt, ist die beglückende Wiederbegegnung mit dem wunderbaren Schauspieler Fritz Kortner, der nichts von seiner einmaligen Ausstrahlung verloren hat. Es bleibt auch ein Bedauern darüber, dass der Film lediglich vor den Filmklubs gezeigt wird. Mag man ihn ablehnen – als notwendiger Diskussionsbeitrag zur Klärung der angeschnittenen Probleme muß er in den deutschen Filmtheatern zu sehen sein.
H. Timm: „Der Ruf“ – umstrittener Kortnerfilm. In: Weser Kurier, Bremen, 16.11.1950.
In der retrospektiven Filmkritik wird der Film sehr unterschiedlich beurteilt.
1967 wird im Evangelischen Film-Beobachter der Film zwar gelobt, weil er von seinem humanen Thema her Gewicht habe, gleichzeitig aber bemängelt, dass der Film künstlerisch nur von sehr zweifelhaftem Wert sei. Im Filmdienst heißt es: „Vom Drehbuch her nicht rundum überzeugend, in der Darstellung der Hauptrolle durch Kortner jedoch beeindruckend.“ Für Bandmann/Hembus reicht es in iher Auswahl der „Filmklassiker“ für den Film nur in die Kategorie „522 weitere Filme“, für sie „kultiviert Der Ruf eine larmoyante Märtyrer-Allüre“. Für K. Nothnagel ist es dagegen ein „außergewöhnlicher FIlm“ bei dem er insbesondere die Schauspielerei Fritz Kortners hervorhebt.
«Obwohl Fritz Kortners ambitionierter Nachkriegsfilm, gerade auch der Ernsthaftigkeit seines Themas wegen, ein kolossaler wirtschaftlicher Misserfolg wurde, ist er neben Peter Lorres DER VERLORENE (1951) das bedeutendste Filmdokument deutscher Remigration.» (Martin Prucha, filmarchiv.at)
Autobiographischer Autorenfilm des Remigranten Kortner, der die biographische
Erfahrung Kortners in einem wesentlichen Punkt zum Nachteil desFilms verändert: statt dem bitter-bösen, aggressiven Witz, mit dem der echte Kortner sich gegen Neo-Nazismus und Antisemitismus gewehrt hat und der diesem Film sehr zugute gekommen wäre, kultiviert Der Ruf eine larmoyante Märtyrer-Allüre.
aus: C. Bandmann/J. Hembus: Klassiker des deutschen Tonfilms 1930-1980 München 1980, S. 234
Um sich zu vergegenwärtigen, wie schwer es die Deutschen mit ihrem kollektiven Gedächtnis haben, muß nun nur das Fernsehprogramm nach alten Filmen durchsehen und den Namen Fritz Kortner suchen. Seit ich Fernsehen kenne, ist mir z.B. der viel unbedeutendere Rühmann bis zum Überdruß bekannt – ihn, der ein Stück unselige Kontinuität der letzten 50 Jahre deutscher Geschichte darstellt, wird man wohl auch zwei Generationen später kennen. Kortner wird man hoffentlich allmählich wieder kennenlernen.
„Der Ruf“, ein außergewöhnlicher Film von 1949, ist ein Stück vergessener Filmgeschichte, das viel mit Kortners Person und Kunst zu tun hat. Das Drehbuch ist von ihm und er spielt die Hauptrolle. Ein jüdischer Wissenschaftler kehrt kurz nach dem 2. Weltkrieg nach Deutschland zurück. Fachliche Anerkennung, Ruhm, kalifornische Sonne haben ihm die Sehnsucht nach der „Heimat“ nicht nehmen können. Ein Ruf an die Frankfurter Universität zieht ihn mitten in die Nachwehen des Nazismus, die bis in kleinste private Zusammenhänge dauern und bis heute anhalten. Dass er einem unbedeutenderen Kollegen vorgezogen wird, bringt ihm Neid und den ungeheuerlichen Verdacht ein, diejenigen vom auserwählten Volk, die nicht getötet wurden, würden nun bevorzugt.
Dass das nur ein lächerlich geringer Versuch von „Wiedergutmachung“ (was für ein Wort!) wäre, paßt schon nicht mehr in die Gedanken der Kleinkarierten, denen man nur die Führung ausgewechselt hat. Das Drehbuch dieses Films beschreibt, wie sich Krieg, politischer Selbstbetrug, ungebrochene Herrschaftsverhältnisse in der Sprache gehalten haben. Deshalb sitzen der Professor und seine Exfrau (Johanna Hofherr) in einer Schwarzmarktkneipe zusammen und reden englisch über ihre gescheiterte Ehe. […]
Veraltet ist an diesem Film nur die miserable Kopie – die Story sieht manches voraus, was uns heute noch und wieder beschäftigt. Vielleicht die nachhaltigste Sensation dieses Films aber ist die Schauspielerei Fritz Kortners, eine aussterbende Kunst von vollendeter Zurückhaltung und innerer Klarheit. „Fühlst Du denn keinen Haß gegen die Deutschen?“, wird er, noch in den USA, gefragt. „In meinen besten Momenten – nein“, sagt der Professor ganz leise im Gehen mit einer fast unmerklichen Kopfbewegung und in einem Tonfall, der scheinbar mühelos Zweifel, Leid und Hoffnung umfaßt.
In Zeiten, in denen jemand wie Brandauer als Schauspieler gilt, muß vor allem auch die Erinnerung an diese Kunst wieder geweckt werden. […]
Klaus Nothnagel: Gedächtnis. In: Tageszeitung, Berlin, 14.3.86
Die deutsche Nachkriegsuniversität in der Diagnose des Spielfilms „Der Ruf“ von 1949
Wenn der deutsche Spielfilm Der Ruf von 1949 überhaupt bekannt geworden ist, dann nicht für seine Darstellung der prekären Situation von Frauen an den Universitäten in Nachkriegsdeutschland, sondern für seine Schilderung von fortdauerndem Antisemitismus unter Studierenden und weit verbreiteten Ressentiments gegen Remigranten. Er erzählt die Geschichte der misslingenden Rückkehr eines deutsch-jüdischen Philosophen auf den Lehrstuhl, von dem er 1933 vertrieben wurde… > weiter
Ulrike Weckel: Brutstätte des Antisemitismus und Männerdomäne: Die deutsche Nachkriegsuniversität in der Diagnose des Spielfilms „Der Ruf“ von 1949. :n: Henning Albrecht u.a. (Hg.): Politische Gesellschaftsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, 2006, S.
Kraftvoller Beleg seiner Kompromisslosigkeit – und seiner Schauspielkunst! – ist der autobiographisch geprägte Film DER RUF, 1948/1949 von Kortner geschrieben und von Josef von Baky in einem realistischen, für die Zeit sehr ungewöhnlichen Wechsel von englischen und deutschen Dialogen inszeniert: Kortner spielt darin einen jüdischen Philosophie-Professor, der nach 15-jährigem Exil in den USA dem Ruf an eine deutsche Universität folgt – und feststellen muss, dass der antisemitische und nationalsozialistische Ungeist auch Jahre nach dem Krieg noch erschreckend lebendig ist. DER RUF ist heute noch ein faszinierendes Zeugnis jener Zeit, allen Legenden vom Neuanfang Deutschlands, der „Stunde Null“, diametral entgegengesetzt. Damals verschwand er gleich wieder aus den Kinos.
Auszug aus: Patrick Seyboth: Fritz Kortner – Bloß keine Behaglichkeit
31.07.2020
Es gibt weder ein Volk von Verbrechern noch ein Volk von Helden. Was weiß ich, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich hätte drüben bleiben können?
Fritz Kortner in der Rolle des Professor Mauthner

Der nach dem Drehbuch von Fritz Kortner inszenierte Film nimmt sowohl von der Thematik als auch in der Darstellungsperspektive eine Sonderstellung unter den deutschen Nachkriegsspielfilmen ein.
Ausgangspunkt der Darstellung ist zunächst eine Gruppe von Deutschen, die sich den Massenmorden und anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im faschistischen Deutschland durch die Emigration in die USA entziehen konnten. Exemplarisch wird an diesen Menschen und ihren amerikanischen Freunden vorgeführt, welche verschiedenen Sichtweisen auf Deutschland und seine Menschen in der unmittelbaren Nachkriegszeit möglich waren. Durch die Augen eines der Emigranten, der sich zur Rückkehr in sein Heimatland entschließt, des von Fritz Kortner verkörperten Professors Mauthner, wird dann kritisch das Nachkriegsdeutschland auf seine Entwicklungsmöglichkeiten hin zu einer menschlichen und demokratischen Gesellschaft betrachtet.
Bei einer Konzentration auf die dargestellte Geschichte (Filmrealität) bieten sich folgende Schwerpunkte zur Besprechung an:
- Die Kontinuität zwischen Faschismus und Nachkriegsgesellschaft, exemplarisch im Universitätsbereich; das Fortleben antisemitischer und nationalsozialistischer Haltungen (Filmsequenz: Geselliger Abend nach der Antrittsvorlesung)
- Die Voraussetzungen für eine demokratische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung der Frage nach der Schuld des einzelnen Deutschen im Dritten Reich (Filmsequenz: Dialoge zwischen Mauthner und seiner Frau)
- Situation von Emigranten in ihrem Zufluchtsland und nach der Rückkehr. 1) Verluste und Zerstörungen an menschlichen Beziehungen, an geistiger und persönlicher Identität (Filmsequenzen: Diskussion unter den Emigranten, Überfahrt nach Europa, Dialog zwischen Mauthner und seiner Frau. In diesem Zusammenhang sollte besonders auf die bewusste Verwendung der englischen Sprache geachtet werden, die zeigt, wie weit die Emigranten von den Nachkriegsdeutschen entfernt waren.
Für die Auseinandersetzung mit diesen Schwerpunktthemen ist besonders auch der Text aus der Illustrierten Film-Bühne, einem gedruckten Begleitheft zu den Kinofilmen, bedeutsam. Darüber hinaus sollten auch Überlegungen einebzogen werden, warum der Film den englischen Titel THE LAST ILLUSION hat.
Obwohl die Filmerzählung selbst nicht Quelle für geschichtliche Ereignisse sein kann, stellt die ihr zugrunde liegende Perspektive einen sensiblen und authentischen Blick „von außen“ auf Verhaltensweisen und Verhältnisse im Nachkriegsdeutschland dar, wie er zu dieser Zeit wohl nur von einem zurückgekehrten Emigranten möglich war, der sich nie arrangiert hatte. (Bezugsrealität)
Das Scheitern des Professor Mauthner im Film weist dabei auf Kortners Interpretation – ein Stück weit auch Analyse – der gesellschaftlichen Situation hin, die herauszuarbeiten wäre: Kortner sieht die Voraussetzungen für eine demokratische Gesellschaft als noch nicht ausreichend gegeben, sieht nationalsozialistische und antisemitische Haltungen nach wie vor verbreitet und fühlt sich als Emigrant fremd im Zufluchtsland und in der Heimat – gleichwohl mit einem Funken Hoffnung am Ende des Films. Und: Aus dem Film spricht das Vertrauen auf die „aufklärerische Kraft der Wissenschaft“.
In diesem Zusammenhang sollten besonders die zeitgenössischen Filmkritiken beachtet werden, in denen von „Vorurteil“, „Irrtum“ und „Subjektivismus“ die Rede ist, Kortners Anliegen – und v.a. schauspielerisches Können – gelobt, aber seine Interpretation der Verhältnisse in Abrede gestellt wird. Kortners Film war kein Kinoerfolg. Daraus lässt sich ableiten, wie begrenzt wirksam die Kortnersche Kritik im damaligen Deutschland gewesen ist.
Filmvergleiche
DER RUF sollte möglichst im Zusammenhang mit dem Film ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN behandelt werden, thematisiert dieser doch ebenfalls ein „Emigrantenschicksal“ – aber aus der Perspektive der Daheimgebliebenen und in der Form anknüpfend an den Gesellschaftsfilm der 30er Jahre. Dieser Vergleich ermöglicht, über die sehr unterschiedlichen Bewußtseinshaltungen und deren Konsequenzen zu reflektieren sowie die Radikalität der Kritik Kortners zu erkennen.
Die Ausnahmestellung des Films zeigt sich darin, wie er die Erfahrung von Krieg zum Ausdruck bringt: DER RUF ist der einzige Film, dem eine ausgewiesen pazifistische Haltung zugrunde liegt, wie sie besonders in der Antrittsvorlesung Mauthners zum Ausdruck kommt. „Die Vorlesung gegen den Krieg enthält den Rückblick auf den Krieg und die Warnung vor der konkreten Gegenwart (1948/49), in der schon wieder von der Notwendigkeit des Krieges gesprochen wird. Der Film bleibt nicht allgemein, sondern spricht gegenwartsbezogen die Einsicht aus, daß Gewalt Gewalt erzeugt und dass es gelte, sich dagegen zu wehren.“ 2)
In diesem Zusammenhang bietet sich ein Vergleich des Films mit den Nachkriegespielfilmen DIE MÖRDER SIND UNTER UNS und IN JENEN TAGEN an.
„Die drei Filme (…) zeigen Grundtypen der Erfahrung von Krieg, die sich mit den drei Positionen der Deutschen verbinden, die keine Nazis waren: Staudtes Film klagt aus der Sicht der linken Opposition die für Kriegsverbrechen Verantwortlichen an. Käutners Film entspricht weitgehend der Position der ‚inneren Emigration‘, die die Menschlichkeit ‚in jenen Tagen‘ sieht, aber zu keiner Konsequenz führt. ( … ) Kortners Film stellt als einziger den Zusammenhang von Nationalsozialismus und Krieg her und ist radikal in der Konsequenz, aber er steht, für Film ganz untypisch, für eine Minderheitsposition, am klarsten artikuliert durch die zurückkehrenden Emigranten.“ 3)
1) In diesem Zusammenhang sollte besonders auf die bewusste Verwendung der englischen Sprache geachtet werden, die zeigt, wie weit sich die Emigranten von den Menschen im Nachkriegsdeutschland entfernt hatten.
2) Irmgard Wilharm: Nachkriegszeiten im Spielfilm, in: Geschichtswerksatt 17, Hamburg 1989, S. 30
3) ebd., S. 31
Detlef Endeward (2021)
Von den fast 500.000 vertriebenen deutschsprachigen Juden kehrten nach 1945 weniger als fünf Prozent zurück, meist aus Weltgegenden, die während des Krieges die letzten gerade noch zugänglichen Zufluchtsstätten gewesen waren: Shanghai und Bolivien, Venezuela und Ostafrika. Andere kamen in fremden Uniformen. Der heutige Nürnberger Gemeindevorsitzende Arno Hamburger etwa gelangte mit der Jüdischen Brigade der britischen Armee aus Palästina über Italien in seine fränkische Heimatstadt, wo er auf dem Jüdischen Friedhof seine Eltern versteckt vorfand. Der ehemalige Mitherausgeber der »Welt am Sonntag«, der aus Augsburg stammende Ernst Cramer, kehrte mit der US-Army zurück, ebenso der spätere Münchner Gemeindevorsitzende Hans Lamm.
Unter den Rückkehrern befanden sich auch einige prominente Namen, wobei die meisten Intellektuellen als überzeugte Sozialisten eher in die sowjetische Besatzungszone gingen. Im Westen gehörten zu den prominentesten Remigranten die Neubegründer der »Frankfurter Schule«, Max Horkheimer und Theodor Adorno.
WARNUNGEN
Vor allem aber kamen Schauspieler zurück, die mehr als alle anderen auf die deutsche Sprache angewiesen waren. Der bekannteste war wohl der 1892 in Wien geborene Fritz Kortner. Einen Tag nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler hatte sich Kortner auf eine Auslandstournee begeben, von der er erst 1947 wieder nach Deutschland zurückkehrte.
Gleich nach seiner Rückkehr spielte Kortner die Hauptrolle in dem Film Der Ruf, dessen Drehbuch er auch geschrieben hatte. Er verkörperte den – wie er selbst – aus dem amerikanischen Exil zurückgekehrten Professor Mauthner, der trotz Warnungen seiner Emigrantenkollegen einen Ruf an seine alte deutsche Universität angenommen hatte. Kaum zurückgekehrt, ist Mauthner bereits mit einem ungebrochenen Antisemitismus und mit dem Neid der von den Alliierten entlassenen ehemaligen Kollegen konfrontiert. Dieser bis heute sehenswerte Film zeigt besser als jedes andere Dokument dieser Zeit, dass es eine radikale »Stunde Null« nicht gegeben hat.
Kortner und seine Frau, die Schauspielerin Johanna Hofer, drückten ihre Zweifel über die Rückkehr nach Deutschland nicht nur im Film, sondern auch in zahlreichen privaten Dokumenten aus. So schrieb Johanna Hofer 1952 an Kortner: »Fritz, wenn du nicht neben mir bist, es ist einfach nicht mehr zu ertragen in Deutschland. Es ist fremd und teuflisch.« Noch 1962 notierte der inzwischen seit Langem in München ansässige Kortner, dass klerikaler Faschismus und Antisemitismus dafür sorgten, »dass kein jüdischer Baum in den Himmel wächst.«
Serie über die Geschichte der Juden in Deutschland nach der Schoa: Folge 4:
1948: Fritz Kortner, »Der Ruf« und die deutsch-jüdische Remigration.
von Michael Brenner in Jüdische Allgemeine, 30.10.2012
| (1) Gesamtzahl der Studenten |
(2) Anzahl d. ehemaligen aktiven Offiziere |
(3) Anzahl d. ehemaligen Reserveoffiziere |
(4) (2) in % von (1) |
(5) (3) in % von (1) |
(6) (2) u. (3) in % von (1) |
|
| Bonn | 3175 | 24 | 657 | 0,75 | 20,69 | 21,44 |
| Köln | 2195 | 44 | 511 | 2,00 | 23,28 | 25,28 |
| Göttingen | 4285 | 197 | 996 | 4,59 | 23,24 | 27,83 |
| Hamburg | 3400 | 70 | 826 | 2,05 | 24,29 | 26,34 |
| Kiel | 2575 | 237 | 213 | 11,14 | 8,27 | 19,41 |
| Münster | 2700 | 62 | 436 | 2,29 | 16,14 | 18,43 |
| TH Aachen | 800 | 10 | 254 | 1,25 | 34,75 | 33,00 |
| TH Han¬nover | 990 | 68 | 194 | 6,86 | 19,59 | 26,45 |
| TH Braunschweig | 1390 | 37 | 401 | 3,38 | 28,84 | 32,22 |
| TiHo Hannover | 410 | 5 | 53 | 1,21 | 12,92 | 14,13 |
| Medizin. Akad. Düsseldorf | 700 | 8 | 18 | 1,14 | 2,57 | 3,71 |
| Kunstakademie Düsseldorf | 176 | 2 | 17 | 1,13 | 9,66 | 10,97 |
| Musikhochschule Düsseldorf | 187 | 0 | 16 | 0 | 8,50 | 8,50 |
| Bergakademie Clausthal | 200 | 34 | 60 | 17,00 | 30,00 | 47,00 |
| SUMME | 23183 | 858 | 4652 | 3,70 | 20,07 | 23,77 |
Mißtrauen gegen die öffentliche Hand – Auseinandersetzung mit dem hannoverschen Hochschulreferenten
Professor Rein fordert in seinem Aufsatz „Hochschule und Staat“ (GUZ vom 30.1.48) die volle geistige und ökonomische Autonomie der Hochschulen und einen Verband solch freier Hochschulen über Staats- und Landesgrenzen hinweg. Seine gewichtigsten Argumente ergeben sich aus jenen Aufgaben und Verantwortungen, die die Hochschulen heute gegenüber Öffentlichkeit und Staat tragen – oder tragen sollten. Das Vorrecht der akademischen Ausbildung ist für ihn unlöslich verbunden mit einem Höchstmaß an Verpflichtung gegenüber allen Mlitmenschen, gleichgültig welcher Nation, Rasse oder Weltanschauung.Das heutige Geistesleben ist seinem Wesen nach grundsätzlich autonom. Was die einzelnen Menschen schöpferisch oder reproduktiv gestatten, beruht auf ihrer individuellen Neigung, Veranlagung, Möglichkeit. Das leuchtet ohne weiteres bei allen Forschungsresultaten, Erfindungen, Kunstwerken usw. ein. Alle fruchtbaren Ideen gehen auf Persönlichkeiten zurück. Da läßt sich nichts planen, kontrollieren, verwalten, es sei denn – hinterher, im einschränkenden oder verbietenden Sinne. Was im Rahmen der Wissenschaft in den Fächern und Disziplinen entstanden ist, gehorcht auch nur seinen eigenen Gesetzen.
Aber auch alle Weiterentwicklung im praktischen Leben hat ihren Ursprung im Ideenreichtum der schöpferischen Neuerer und Reformatoren – oder deren Lehrer. Aus neuen Ideen nur kann sich auch eine angemessene neue Lösung der Lebenspraxis entwickeln.
Aus diesem autonomen Geistesleben allein können sich auch die besten Gedanken über Erziehung, Sozialismus, Politik usw. ergeben. Es wird wohl niemand bezweifeln, daß das soziale Leben und alles, was mit dem Staate zu tun hat (besonders in Deutschland), heute krank ist. Wie kann man aber eine Gesundung – aus neuen Ideen, neuen Möglichkeiten heraus – erwarten, wenn dieses kranke soziale Leben überall da hineinwirken und -kommandieren darf, wo seine eigene Gesundheit allein entspringen kann? Das ist der Zustand der staatlichen deutschen Hochschulen.
[In] „Reform vor Autonomie“ fordert [das] v. Oertzen (GUZ v. 27.2.48). Er hält es für ungerechtfertigt, das Mißtrauen gegen die öffentliche Hand, wie es aus den Zeiten des totalitären Staates hervorging, „nun kritiklos auf die Demokratie zu übertragen“. Es soll hier außer Betracht bleiben, wie weit man heute oder in absehbarer Zeit bei uns von Demokratie sprechen kann. Aber ist das tiefe Mißtrauen so vieler ernst zu nehmender Menschen gegen die öffentliche Hand wirklich „kritiklos“? Mir scheint, die betonte Reserve der Mehrzahl der Studenten gegenüber allem Parteileben und Staatlichen entspringt nur zu berechtigter Kritik. Mit wachsender Hoffnungslosigkeit beobachtet man die Handlungen jener riesigen Bürokratenmaschine, die sich zum Beispiel vergeblich bemüht, die allgemeine Not gerecht zu verteilen.
Es handelt sich nicht darum, die sehr berechtigten Reformwünsche v. Oertzens zu leugnen. Sicher brauchen wir eine durchgreifende „innere Reform“. Aber angesichts eines Staates und von politischen Auffassungen und Praktiken, die reformbedürftiger sind als alles andere, erscheint es als glatter Widersinn, gerade von hier aus energische äußere Eingriffe zu verlangen. Auch dürften diese das genaue Gegenteil von Demokratisierung der Selbstverwaltung darstellen, die v. Oertzen (sehr mit Recht) fordert. Mir scheint, er sieht den Wald vor Bäumen nicht. Denn eigentlich enthält die Forderung von Professor Rein genau das, was er wünscht.
Wenn der genannte Verfasser aber meint, die Hochschule habe „junge Menschen zu verantwortungsbewußten Staatsbürgern zu erziehen“, so muß hier im Sinn von Professor Rein – mit allem Nachdruck protestiert werden. In einer Demokratie zumindest gibt es keine Erziehung zum Staatsbürger. Nebenbei: Was sollte es auch für einen Sinn haben, zum bayerischen, niedersächsischen oder – Bremer Staatsbürger erzogen zu sein?
Jenes Bild des Menschen, wie es Professor Reins übernationalem Hochschulverband als Erziehungs- und Lebensideal vorschwebt, steht viel höher als jeder mögliche Staatsbürger. Absolute Wahrhaftigkeit und Sachlichkeit im Denken, freies Verantwortungsbewußtsein und warmes Helfen- und Schaffenwollen, das sind die höchsten Qualitäten, die an keine Nationalität gebunden sind. Solche Menschen aber sind dann – neben Familienvätern und -müttern und guten Berufstätigen – auch die besten Staatsbürger. Denn der Staat ist für den Menschen da und nicht umgekehrt! –
Weich ganz andere Auffassungen vom Staat heute durchaus möglich und vielleicht sogar wirksam sind, zeigt ein genaues Studium der kleinen Schrift „Hochschulprobleme von heute“[1]. Wohl in bewußter Antithese zu Professor Rein heißt dort das 1. Kapitel „Staat und Hochschule“. Obwohl der Verfasser betont, als Privatmann zu schreiben, kommt den Ausführungen des Leiters der Hochschulabteilung im niedersächsischen Kultusministerium wohl beträchtliche Bedeutung zu. Man darf dankbar sein, hier auch von einem Fachmann eine Fülle von vielseitigen Gedanken kennenzulernen, die das Thema weiter klären können. Doch die Art, wie sich hier – mehr zwischen den Zeilen – das Bild des Staates abzeichnet, und wie auf der anderen Seite die tieferen Gründe von Professor Rein überhaupt nicht gesehen – oder gewürdigt – werden, laßt das Unbefriedigtsein zur Sorge werden. Kennzeichnend sind einige unversöhnliche Antinomien, wie sie uns aus der Zeit nach 1933 wohl vertraut sind.
In jenem ersten Kapitel heißt es: „Wahrheitssuche ist nur in voller Freiheit aussichtsreich.“ Eine Seite weiter jedoch wird von den Anforderungen des Staates an die wissenschaftliche Lehre „in weitanschaulich gebundenen Fächern“ (Geschichte, Staatslehre, Politik, Soziologie u. a.) gesprochen und gefragt: „Kann man es dem Staate verargen, wenn er hier in aller Eindeutigkeit den Standpunkt vertritt, daß bestimmte Lehren weitanschaulicher und politischer Art, die an seine Grundlagen rühren, an den Hochschulen auch dann nicht gelehrt werden dürfen, wenn sie mit dem Anspruch auftreten, das Ergebnis objektiver Wahrheitssuche zu sein?“ Wo bleibt die oben geforderte „volle Freiheit“? Freilich, auch hier wird später zugegeben, daß „diese Forderung des Staates an die Hochschule leicht mißbraucht werden kann“. Demgegenüber wirkt der Hinweis auf die „Bedürfnisse der Volksgesamtheit“ blaß, Wahrheit und Objektivität sind nicht durch Mehrheitsbeschlüsse und Volksabstimmungen zu ermitteln. Darum wiegt die Stimme jedes Menschen nur nach seiner Urteilsfähigkeit, nicht aber nach dem Grade seiner Macht oder Beauftragung. Man muß es also dem Staate unter allen Umständen nicht nur „verargen“, sondern unmöglich machen, sich Rechte anzumaßen, die er gar nicht haben kann.
Was aber bedeutet der Wille, nichts zu dulden, was an „seine (des Staates) Grundlagen rühren“ könne anders als den absoluten Konservatismus? Da ist dann merkwürdig, weiter unten als Vorwurf zu lesen: „Die Hochschule ist vorwiegend eine Welt konservativer Bewährung“ oder „die großen Neuerer sitzen selten auf den Kathedern der Hochschulen“. Lassen wir den Widerspruch – gerade vom Beispiel der neuesten Physik herleitbar – beiseite und fragen: Saßen die Neuerer etwa häufiger in den Staatsregierungen? Sind Staaten, die auf die Erhaltung ihrer Grundlagen so bedacht sind, nicht das stärkste Hindernis für alles Neue und Bessere?
„Nur ein geistiger Wandel kann die Wiederkehr der Diktatur unmöglich machen.“ Sehr wahr! Wessen Aufgabe aber ist es, im Sinne eines solchen Wandels, eben auf dem Gebiet des geistigen Lebens, tätig zu sein? Doch wohl die Aufgabe aller jener geistig Arbeitenden, deren Zentrum und Ausbildungsinstitute die abendländischen Hochschulen darstellen. „Wandel“ bedeutet eben unter anderem auch ein Rühren an den Grundlagen. So bleibt die völlige Autonomie der Hochschulen (und nur die auch ökonomische ist wirklich) als unumstößliche Notwendigkeit bestehen.
Besonders deutlich wird das am Beispiel der Nürnberger Ärzteprozesse. Der Verfasser meint, die dort getroffenen erschütternden Feststellungen wären nicht möglich gewesen, „wenn die medizinischen Fakultäten sich immer bewußt gewesen wären, daß sie dem deutschen Volk nicht nur Mediziner, sondern Ärzte bescheren sollte“. Arztsein sei aber nicht zuletzt eine Frage des Ethos. Wie kann ein Verfechter der staatsabhängigen Hochschulen diesen Vorwürfe machen, wenn sie das Ethos ihres Staates gelehrt und vertreten haben?! Das so oft behauptete „Versagen“ der deutschen Hochschulen hat – zwar nicht den alleinigen – aber schwerwiegenden Grund eben darin, daß es einen wirksamen Widerstand gar nicht geben konnte.
Als Zentralfrage wird angesehen: „Wie weit ist es in Würdigung der heutigen staatspolitischen und kulturellen Situation sinnvoll, daß der Staat den Hochschulen einen Raum ausspart, in dem sie nach eigenem Ermessen und selbstverantwortlich tätig sein können?“
Die Frage läßt sich so deshalb nicht beantworten, weil sie die Wirklichkeit auf den Kopf stellt. Es gibt gar keinen Staat (außer einem totalitären), der alles Leben beherrscht, so daß jede eigene Entscheidung eines Institutes oder Institut-Verbandes ein „Aussparen“ sein könnte. Das Ermessen des „Staates“ (sprich: des Kultusministeriums) ist keineswegs höher anzusetzen als das eines Gremiums der führenden Hochschulmänner. Und schließlich ist jeder Dozent grundsätzlich „selbstverantwortlich“. Wie wenig ihn ein Staat davon entlasten kann, beweisen die Urteilsbegründungen aus Nürnberg zur Genüge. Die Zentralfrage müßte tatsächlich etwa lauten: Wie weit ist es … überhaupt noch zu verantworten, daß der Staat seine Macht auf einem Gebiet mißbraucht, in dem allein Fachkenntnis- und freie Gewissensentscheidung der Vertreter für Verhandlungen und Entschlüsse maßgeblich sein können?
Der Verfasser der „Hochschulprobleine‘ mißversteht so auch völlig die Gründe aus der „politischen Beweisführung“. Er lehnt sie mit den Worten ab, der Hinweis auf Verhüten der Kneblung der Wissenschaft, wie sie der Nationalsozialismus gebracht habe, sei unberechtigt; denn „gegen totalitäre Systeme helfen keine Paragraphen!“ Ganz gewiß ist es unmöglich, eine idyllische Insel der Freiheit mit der Hochschulautonomie zu erreichen. Wie steht es aber mit dem Zustandekommen eines totalitären Systems? Sollte sich ein freier, übernationaler Hochschulverband nicht als wirksames Mittel gegen jede solche Tendenz bewähren?
Ferner lesen wir: „Die Gefahr der parteipolitischen Besetzung des Lehrstuhls durch den Minister ist theoretisch vorhanden, aber praktisch nicht sehr groß.“ Es ist eine Illusion, das bloße Persönliche Vertrauen, sagen wir zu einem Minister, an Stelle einer klaren rechtlichen Abgrenzung der Befugnisse zu setzen. Es geht um mehr als Kritik an einzelnen Beamten. Ist jener vertrauenswürdig, so besteht gar kein Anlaß, eine Meinung zur Geltung zu bringen, die der seinen zuwiderläuft. Ist er – oder sein Nachfolger – es aber nicht mehr, so wird er, wenn er die Macht hat, nichts anderes tun, als mit allen Mitteln jene Stimme des Widerspruchs zum Schweigen zu bringen. Je notwendiger schonungslos offene Kritik ist, desto größer auch der sicher zu erwartende Mißbrauch der Gewalt durch den Staat.
Die Hochschulen können ihre Aufgabe als Hüter des Suchens nach Recht und Wahrheit nur erfüllen, wenn sie den freien Raum dafür zur Verfügung haben. Der demokratische Staat, in seiner besten Gestalt, wird es als vornehmste Aufgabe ansehen, all jene schützenden und sichernden Rahmen darzustellen, in denen sich das pulsierende, fließende, ewig wandelbare Leben – je unstaatlicher, desto fruchtbarer – entfalten kann. Ein Staat, der durch Statuten seine Hochschulen im Rahmen eines Hochschulverbandes frei läßt, „spart“ nichts „aus“, sondern erfüllt seine fundamentale Aufgabe. Sofortige volle Autonomie der Hochschulen – und des gesamten Geisteslebens überhaupt – als Voraussetzung jeder Reform, muß unser aller Anliegen sein.
Rainer v. Zastrow, cand. rer. nat., Göttingen.
Rainer v. Zastrow: Keine Reform ohne Autonomie. In: Göttinger Universitäts-Zeitung 3. Jg., Nr. 14. 25.6.48.
[1] Von Kurt Zierold, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1948.
- Helmut G. Asper: Fritz Kortners Rückkehr und sein Film Der Ruf. In: Helmut G. Asper (Hrsg.): Wenn wir von gestern reden, sprechen wir über heute und morgen. Sigma, Berlin 1991, S. 287–300.
- Klaus Völker: „Aufklärung ist wichtiger als Verurteilung“: Zu Fritz Kortners Film Der Ruf. In: FilmExil 3, 1993, S. 5–12.
- Ulrike Weckel: Brutstätte des Antisemitismus und Männerdomäne: Die deutsche Nachkriegsuniversität in der Diagnose des Spielfilms Der Ruf von 1949. In: Henning Albrecht u. a. (Hrsg.): Politische Gesellschaftsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Festgabe für Barbara Vogel. Hamburg 2006, S. 119–132.