Der Regisseur als privilegierter Rezipient
Grundsätzliche Überlegungen zu den Verfilmungen „Das Brot“, „Die Flucht“ und „Nachts schlafen die Ratten“ von Wolfgang Küper
 Kein Schriftsteller oder Dichter hat per se das Recht auf die kanalisierte Rezeption seiner Werke. Die Leser und Publikum entscheiden, wie und in welcher Form interpretiert wird. Jeder tut dies so gut er kann, entsprechend seinen sozialen und seelischen Voraussetzungen. Beim Lesen entsteht dann durch das Hinzufügen der Phantasie bei jedem einzelnen Leser eine eigene Bildergeschichte, ein individueller Film.
Kein Schriftsteller oder Dichter hat per se das Recht auf die kanalisierte Rezeption seiner Werke. Die Leser und Publikum entscheiden, wie und in welcher Form interpretiert wird. Jeder tut dies so gut er kann, entsprechend seinen sozialen und seelischen Voraussetzungen. Beim Lesen entsteht dann durch das Hinzufügen der Phantasie bei jedem einzelnen Leser eine eigene Bildergeschichte, ein individueller Film.
Der Regisseur, der Literatur verfilmt, ist nichts anderes als ein privilegierter Rezipient, der seine beim Lesen erzeugten Visionen verwirklichen und veröffentlichen darf. Allein ökonomische Zwänge können ihm dabei im Wege stehen.
Beim Interpretationsvorgang selbst gibt es meiner Meinung nach keine Einschränkungen, solange das Essenzielle der Textvorlage zum Wesentlichen der Interpretation wird. Der geistige Kern muss erhalten bleiben, sonst wird die Geschichte missverstanden und die Verfilmung misslingt. Ganz bestimmt kommt es aber nicht darauf an, das Dichterwort buchstäblich in Bilder zu übersetzen. Die Stärke einer Literaturverfilmung besteht oftmals gerade darin, dass sie sich von ihrer Vorlage in Teilen entfernt oder sogar distanziert. Selbstverständlich muss sich auch jede Verfilmung, die diese Grundsätze berücksichtigt, einer grundsätzlichen Kritik stellen.
Die Verfilmung von Literatur ist nicht einfach, die anschließende Kritik zu ertragen aber auch nicht. Denn schnell stürzen sich die Kritiker auf das Filmwerk. Angefangen mit denen, die das „heilige Gut der Sprache“ missbraucht sehen, über die, welche die Verfilmung nur dann akzeptieren, wenn sie den Text wortwörtlich in Bilder übersetzt – abgesehen davon, dass das unmöglich ist, wäre dies auch nicht der Sinn einer Literaturverfilmung – bis zu denen, die die eigene Interpretation vorziehen und nichts anderes gelten lassen wollen. Ich habe mich dennoch darangewagt und möchte im folgenden erklären, warum bei der filmischen Arbeit selbst gravierende Abweichungen von der Vorlage notwendig sein können und man dann immer noch von einer Literaturverfilmung sprechen kann.
Hier geht es nun also um die Verfilmungen der Kurzgeschichten „Auf der Flucht“ von Wolfdietrich Schnurre und „Das Brot“ sowie „Nachts schlafen die Ratten doch“ von Wolfgang Borchert. Schnurre hat seine Geschichte in einer hoffnungslosen Zeit geschrieben. Die Figuren, die er erfand, handeln wie fremdbestimmt. In der sprachlichen Form, also der Erzählung, ist dieser extreme Fatalismus erträglich. Für die bildliche Form, die Verfilmung, ist er dagegen für mich nicht hinnehmbar. Figuren, die auf der Leinwand bestehen sollen, müssen Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten, mit Tendenzen zu Gut und Böse sein. Sie benötigen ein Profil, um fesseln zu können. Ein allgegenwärtiger und über allem schwebender Fatalismus wie in der Geschichte ließe an der Inszenierung zweifeln, verhinderte den Kontakt und die Identifizierungsmöglichkeit mit den Schauspielern und den durch sie verkörperten Figuren.
Also isst der Mann das Brot nicht wie in der Erzählung in Folge seiner Angst, er könne das Brot an den Regen verlieren, sondern er isst es, weil er selber Hunger leidet und er in einer unglückseligen Sekunde seines Lebens die Kontrolle über sich verliert und dem egoistischen und fordernden Teil seiner Persönlichkeit nachgibt. Der Regen spielt hier eigentlich nur eine sekundäre Rolle. Er bestimmt lediglich den Zeitpunkt des Zugriffs. Er macht das Brot angreifbar. Wenn der Mann in Schnurres Geschichte zur Frau zurückkehrt, reagiert sie auf die negative Beantwortung ihrer Frage genauso liebevoll gleichmütig, ja fast gleichgültig, wie bei seinem Weggehen. Meinem Empfinden nach fand nichts statt zwischen diesen Menschen, was jetzt hätte geschehen müssen.
So war die Geschichte für mich nicht verfilmbar. Ich wollte zwei Individuen aus Fleisch und Blut, die man versteht, die man lieben oder hassen kann. Auf keinen Fall wollte ich Kunstfiguren. Also füllte ich den Raum zwischen den beiden mit Gefühlen und Emotionen und inszenierte so, dass der Mann sich durch sein Verhalten verrät und die Frau begreift, dass er lügt und er begreift, dass sie begriffen hat, dass er lügt.
Für all das brauchte ich nur Blicke und eine inszenatorische Idee. Ab diesem Moment haben die drei Schauspieler keine gemeinsame Einstellung mehr. Die familiäre Gemeinschaft ist zerrissen, die Familie zerstört, innerlich und äußerlich. Wenn der Mann in der letzten Szene seinen toten Sohn in die Arme nimmt und ihm ein letztes Mal sein Schlaflied singt, so ist auch dies ein fatalistischer Akt. Der verzweifelte Versuch, die Tat ungeschehen zu machen, die Welt für den Rest der Zeit zum Stillstand zu bringen, und doch die Gewissheit zu haben, dass er daran scheitern muss. Im Gegensatz zum Ende der Erzählung wollte ich, dass ein Kampf stattfindet. Er wird zwar verloren, aber man kann verstehen, warum und vor allem wie er verloren wird.
Die Tatsache, dass ich das Kind mit einem etwa achtjährigen Jungen und nicht mit einem Säugling wie in Schnurres Text besetzt habe, liegt einzig und allein in meinem subjektiven Eindruck begründet, welcher den Tod eines älteren Kindes als schmerzhafter empfindet. Alle Mütter mögen mir dies verzeihen.
Dann „Nachts schlafen die Ratten doch“. Ursprünglich gar nicht so vorgesehen, erschien mir Borcherts Erzählung, die ich seit längerer Zeit verfilmen wollte, nach einigen Überlegungen als genau die Möglichkeit, dem Mann die Chance zu geben, seine schwere Schuld wenigstens zum Teil wieder gutzumachen. Das war mir in Hinblick auf meine jüngsten Zuschauer wichtig. So wurde aus einer zu anderer Zeit von einem anderen Autor geschriebenen Erzählung die Weiterführung der Erlebnisse „meines“ Mannes aus der „Flucht“. Seine Frau, so erfahren wir, ist nicht mehr am leben. Sie starb kurz nach ihrem Sohn (aus Trauer?). Der Mann lebt nun völlig vereinsamt mit seinen Kaninchen. Er verhält sich merkwürdig, redet mit den Tieren. Ein Mensch, der die Hoffnung aufgegeben hat, dessen Licht aber noch nicht ganz erloschen ist. Dann macht er zufällig die Bekanntschaft des verwaisten Jungen und erkennt seine einmalige Chance. Wieder ist es ein Kind und wieder spielt das Brot eine wichtige Rolle. Durch diese Änderung bekommt der Film eine tiefere Dimension.
Borchert erzählt seine Geschichte aus der Sicht des Jungen. Ich habe die Erzählposition verändert, weil der Text nur so verfilmbar wird. Der Junge schweigt, er hütet sein Geheimnis. Der Mann aber drängt das Kind, die Wahrheit auszusprechen. Er treibt die Geschichte voran, es ist seine Geschichte.
So sehr ich für das „Brot“, die „Flucht“ und die „Ratten“ von dem Stilmittel „schwarz-weiß“ überzeugt bin, so sehr tut es mit leid, durch diese Entscheidung die wunderbare Farbmetaphorik des „Ratten“-Textes nicht in meinem Film integriert zu haben. Aber beim Filmemachen muss man Entscheidungen treffen und die Entscheidung für das Eine oder das Andere ist manchmal auch eine Gewähr dafür, bescheiden zu bleiben. Und Bescheidenheit in der Wahl der stilistischen Mittel ist eine Voraussetzung, eine Entsprechung für die Kargheit der Sprache, die diese Nachkriegsautoren auszeichnet, finden zu können.
 Den produktionstechnisch letzten Teil der Trilogie, „Das Brot“, innerhalb der Chronologie allerdings der erste Teil, hätte ich niemals zu verfilmen gewagt, hätten die anderen Teile nicht bereits existiert. Zu handlungsarm erschien mir die Erzählung, zu innerlich die Problematik. Allmählich näherte ich mich dem Text und entdeckte bei jedem erneuten Lesen weitere Aspekte.
Den produktionstechnisch letzten Teil der Trilogie, „Das Brot“, innerhalb der Chronologie allerdings der erste Teil, hätte ich niemals zu verfilmen gewagt, hätten die anderen Teile nicht bereits existiert. Zu handlungsarm erschien mir die Erzählung, zu innerlich die Problematik. Allmählich näherte ich mich dem Text und entdeckte bei jedem erneuten Lesen weitere Aspekte.
Zum Beispiel die Tatsache, dass sowohl Borchert als auch Schnurre ihren Texten keine exakten Zeitangaben zuordnen, schien das Vorhaben zu erleichtern. Die Zeitspanne „Zweiter Weltkrieg“ war der einzige Hinweis. Nur die „Ratten“ sind zeitlich genauer festzulegen, denn Bomben fielen auf Deutschland erst ab 1943.
Mit den beiden anderen Filmen im Hintergrund hatte ich die Möglichkeit, dieses hermetische Werk aufzubrechen und gleichzeitig auszuweiten. Alles, was hinzukam, stand im Dienst der Erzählung, war gewissermaßen eine Aufblähung des Borchertschen Mikrokosmos.
Viele Symbole und Handlungsstränge, die in den beiden anderen Filmen eine wichtige Rolle spielten, konnte ich sowohl inhaltlich als auch inszenatorisch vorbereiten. Das führt zu einer intensiveren Wirkung bei „Flucht“ und „Ratten“.
Zum Beispiel das Schlaflied des Kindes, jedesmal gemäß des Anlasses vom Vater verschieden vorgetragen; die Vorbereitung der Flucht mit Hilfe eines Globus (Amerika) und dann die Flucht, die zu Fuß durch die heimatlichen Wälder führt; die jüdische Herkunft der Frau und das erste Schuldigwerden des Vaters, welches das zweite Mal um ein vieles grausamer erscheinen lässt.
Und wieder gab es ein Problem, aus literarischen Figuren Filmpersönlichkeiten zu formen. Wenn ein so elementares Geschehen, wie von Borchert erzählt, filmisch dargestellt werden soll, müssen wir über die Menschen, die es erleben, mehr erfahren. Erst durch die eindeutige Charakterisierung werden die Stärken und Schwächen der Figuren wirklich erfahrbar und glaubwürdig. So müssen sie zuerst einmal zum Leben erweckt werden.
Denn das Wichtigste im Kino ist nicht nur die Glaubwürdigkeit der Geschichte, sondern mehr noch die Glaubwürdigkeit der Figuren in der Geschichte.
In einer Kurzgeschichte treffen wir aber ohne Vorbereitung auf Personen, die wir nicht kennen und steigen mitten in deren Geschichte ein. Genauso plötzlich verlassen wir Geschichte und Personen auch wieder. In diesem Sinn ist eine Kurzgeschichte nicht zu verfilmen, denn der Film gehorcht anderen Gesetzen. Sie zu berücksichtigen ist die Voraussetzung dafür, dass die Verfilmung der Erzählung zu einem ebenbürtigen Erlebnis werden kann.
Literatur und Film haben für einen kurzen Moment zusammengefunden. Sie haben sich gegenseitig positiv berührt und sind dennoch geblieben, was sie eigentlich sind. Die Literatur der Ausdruck des Geistes und der Phantasie und der Film der Quell für Sinnesempfindung und Emotion. Welch ein Glück, dass es beide gibt!
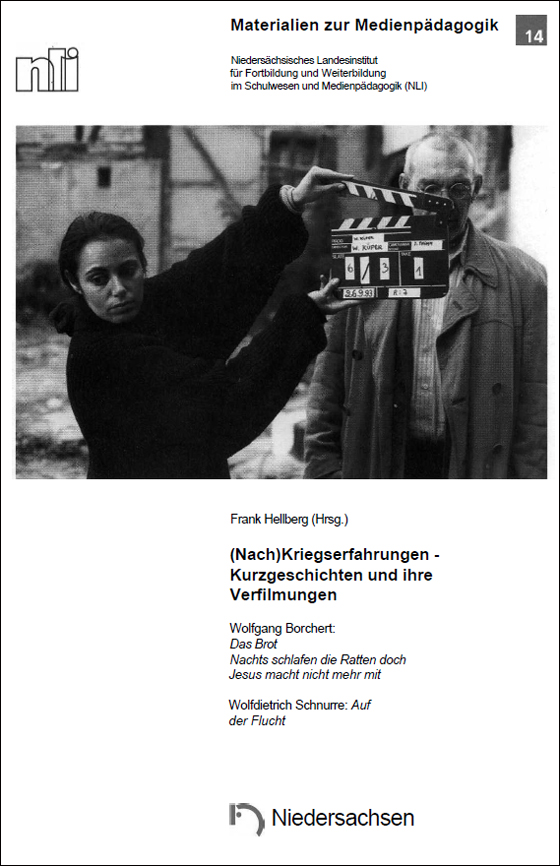
(Nach)Kriegsgeschichten und ihre Verfilmungen im Literaturunterricht
Die Filme
Arbeitshinweise
- Der Regisseur als privilegierter Rezipient
- Hinweise zur Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsvorschläge
- Arbeitshinweise und Unterrichtsvorschlag zu „Das Brot“
- Arbeitshinweise und Unterrichtsvorschlag zu „Auf der Flucht“
- Arbeitshinweise und Unterrichtsvorschlag zu „Nachts schlafen die Ratten doch“
- Literaturhinweise


